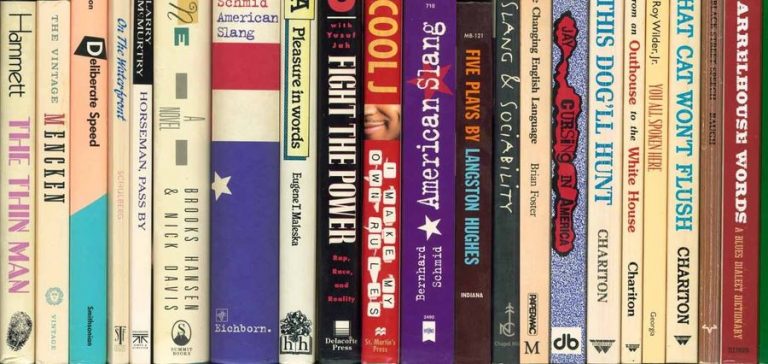Ich habe hier schon mal auf mehr oder weniger eindeutige Zweideutigkeiten in Songtexten verwiesen. Und darauf dass die platte Direktheit etwa im Rapgenre trotz netter Prägungen wie »knockin’ boots« die sexuelle Metapher weitgehend verdrängt hat. Die Anfänge dieser Verdrängung fallen in eine ganze andere Ära, nämlich in die Zeit, in der schwarze Musik den weißen amerikanischen Markt zu erobern begann. Und verdrängt wurden die Metaphern damals mitnichten durch Direktheit – man merzte sie einfach aus. Solange die schwarze Musik als »race music« ein vorwiegend schwarzes, sexuell weniger verkrampftes Publikum gehabt hatte, waren die metaphernlastigen Texte niemandem aufgestoßen, als man die Musik dann einem weißen Publikum verkaufen wollte, wurden sie zum Problem.
1954. Die heiße Affäre zwischen Country Music und Rhythm & Blues hatte Folgen gehabt: Amerika wand sich unter den Geburtswehen des Rock ’n’ Roll. Finanziell gesehen hätte der schwarzweiße Mischling es nicht besser treffen können, der Zweite Weltkrieg hatte den Amerikanern einen nie gekannten Reichtum beschert. Und das galt auch für die schwarzen Amerikaner, obwohl sie sich nach wie vor als Menschen zweiter Klasse behandelt sahen. In dieser Hinsicht erblickte der Rock ’n’ Roll also unter gelinde gesagt eher prekären Verhältnissen das Licht der Welt. Das hatte zur Folge, dass es nach wie vor nach Rassen getrennte Märkte gab und dass man den quäkenden Kleinen für das blütenweiße Amerika etwas zurechtmachen musste. Bei all den Gefahren, die das blütenweiße Amerika in dem unehelichen Bankert bald wittern sollte, vom Text her war er, verglichen mit dem, was das schwarze Elternteil da mitgebracht hatte, herzlich zahm.
Mit das beste Beispiel für diese Hygienisierung bietet die inoffizielle »Nationalhymne des Rock ’n’ Roll«, Bill Haleys Rocker »Shake, Rattle and Roll«. Geschrieben hat ihn Jesse Stone1 auf Geheiß von Labelchef Herb Abramson für den Blues Shouter Big Joe Turner, der den Song denn auch einspielte. »Shake, Rattle and Roll« war eben die Nummer Eins der R ’n’ B‑Charts, als Bill Haley und seine Comets ihn im Juni 1954 aufnahmen. Allerdings mit frisiertem, ach was, mit gekämmtem Text. Das beginnt damit, dass Big Joe seine »Mama« aus dem Bett schmeißt, damit sie ihm das Frühstück macht. Nicht zu vergessen mit der Aufforderung, dass sie sich vorher die Hände waschen soll:
Get outta that bed, wash your face and hands,
Get outta that bed, wash your face and hands.
Well, you get in that kitchen, make some noise with the pots ’n’ pans.
In einer Gesellschaft, deren »verfilmte« Bettszenen noch vom Hays Code reguliert waren,2 konnte so kein Popsong beginnen. Probieren wir’s mal lieber so:
Get out from that kitchen and rattle those pots and pans,
Get out from that kitchen and rattle those pots and pans.
Well, roll my breakfast, cause I’m a hungry man.
Was die gute Frau ohnehin maßlos verwirrt haben dürfte: Wie sollte sie ihren hungrigen Kerl bekochen, wenn sie aus der Küche »rauskommen« sollte? Aber vielleicht sehe ich das etwas zu eng. Interessanter ist ohnehin der zweite Vers. Da scheint doch glatt die Sonne durchs Kleid und legt dem anerkennenden Blick eine offensichtlich stattliche Silhouette frei:
Way you wear those dresses, the sun comes shinin’ through,
Way you wear those dresses, the sun comes shinin’ through.
I can’t believe my eyes, all that mess belongs to you.
»Mess« war im Slang damals übrigens noch was Gutes – Big Joe kann also nicht glauben, was sie für feine Sachen unter dem Kittel hat. So oder so, für Bill Haley macht man daraus:
Wearin’ those dresses, your hair done up so right,
Wearin’ those dresses, your hair done up so right.
You look so warm, but your heart is cold as ice.
Sie trägt also nur noch nicht näher definierte Kleider, was eigentlich gar nichts sagt, da die alle Frauen anhatten; wenn die Fummel wenigstens »tight« gewesen wären, der Reim, der sich dem Texter doch aufgedrängt haben muss. Aber offensichtlich war schon das zu eindeutig. Und dass die Frau plötzlich als eiskalt bezeichnet wird? Nun ja, für Big Joe ist sie immerhin der »Teufel«, weil sie sein Geld schneller zum Fenster rauswirft, als er es verdienen kann. Bleiben wir also lieber bei den Metaphern. Und hier wird es erst richtig interessant, denn gerade hier ist den Saubermännern ein richtig fetter haben durch die Lappen gegangen. Heißt es doch in der »weißen« wie der »schwarzen« Version des Songs »I’m like a one-eyed cat peepin’ in a seafood store«.
I’m like a one-eyed cat peepin’ in a seafood store,
I’m like a one-eyed cat peepin’ in a seafood store.
Well I can look at you till you ain’t no child no more.
I’m like a one-eyed cat, peepin’ in a sea-food store,
I’m like a one-eyed cat, peepin’ in a sea-food store.
I can look at you, till you don’t love me no more.
Tja, und so putzig das Bild von der Katze in der Fischhandlung auf den ersten Blick sein mag, es ist eine knallharte Sexmetapher ganz in der handfesten Tradition des Blues. Das Bild des Penis als »einäugiges« Wesen, meist ein Tier, ist alt und heute noch en vogue. Meine Datenbank spuckt auf die schnelle zwei Dutzend Beispiele aus, von denen die »one-eyed trouser-snake« wohl die geläufigste ist.
Und der »seafood store«? Nun, ich bin nicht ordinärer als Sie und kann nichts dafür, aber »fish« ist nun mal ein Bild für die »lady parts« aus einer Zeit in der die körperliche Hygiene noch tatsächlich ein Problem war. Und es hat sich gehalten. Im Schwulenjargon etwa, der – Will & Grace ungeachtet – ein misogynes Element nicht leugnen kann, findet sich »fish« noch heute immer wieder als Metapher für »Frau«. Und im schwarzen Slang hatte die Anspielung nie etwas Negeatives gehabt. Ein weiteres berühmtes Beispiel aus der populären Musik ist der Text zu »Hold Tight (Want Some Seafood, Mama)«, einer alten Fats Waller-Nummer, die selbst der womöglich nur gefunden hat. Laut Sidney Bechet gab es sie bereits in New Orleans, als Fats noch ein kleiner Bub war.
Want some sea food mama
Shrimps and rice they’re very nice
I like oysters, lobsters too,
I like my tasty butter fish, fooo
When I come home late at night
I get my favorite dish, fish
Die Andrew Sisters (»Rum and Coca-Cola«) hatten mit »Hold Tight« 1939 einen Hit. Angeblich nahm man die Single vom Markt, als man dahinter kam, was es mit dem »seafood« im Text auf sich hatte.3 Ob dem tatsächlich so war, mag dahingestellt sein, Tatsache ist, dass »seafood« hier ebenso für Sex steht wie in anderen Bluestexten.
Nehmen wir Peetie Wheatstraw;4 bei ihm heißt es:
I want some seafood, mama, and I don’t mean no turnip greens
I want some fish, oooh, well, well, and you know just what I mean.
I want fish, fish, mama, I wants it all the time.
I want fish, fish, mama, I wants it all the time.
The peoples call it seafood, oooh, well, well, all up and down
the line.
If you love your seafood, you is a good friend of mine. (x2)
If you don’t love good fish, oooh, well, well, you better get on
some kind of time.
Peetie Wheatstraw, I Want Some Sea Food
Und Blind Boy Fuller wirft seiner »mama« in »What that smell like fish« vor, ihren »fish« einem anderen Kerl vorgesetzt zu haben:
What’s that smells like fish, baby?
Food, if you really wants to know.
Smell like sardines and it ain’t in no can.
Same doggone thing you chucked at the other man.
What that smell like fish, mama?
Etwas »hot tuna«, gefällig?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 |
 |
 |
 |
 |
 |
- Charles E. Calhoun ist nur ein Pseudonym [↩]
- IX. Locations: The treatment of bedrooms must be governed by good taste and delicacy. December 1956 [↩]
- Ich habe die Behauptung vor Jahren mal in einem Forum gefunden, aber nie nach einer Bestätigung gesucht. [↩]
- mehr dazu in Paul Garon, Blues & the Poetic Spirit, New York: Da Capo Press, 1978 [↩]