
Die taz hatte zum Wochenende einen – wenigstens meiner Ansicht nach – recht gescheiten Artikel zum Thema »Übersetzungskritik im Feuilleton«.1
Sicher, so die Autorin Katharina Granzin, der Übersetzer komme bei den Rezensenten in der Regel zu kurz, aber für eine »fachlich gesicherte Würdigung der Übersetzerleistung im Rahmen einer Literaturkritik« fehle nun mal »oft die faktische Grundlage.« Der Rezensent habe das Original entweder nicht neben sich liegen oder sei der Ausgangssprache nicht mächtig genug, um sich diesbezüglich ein Urteil zu erlauben. Und überdies könne »die philologische Feinanalyse … auch nicht wirklich die Aufgabe der Kulturjournalisten sein.«
Applaus, Applaus! Für mich bringt das die ganze Geschichte auf den Punkt. Ich hatte ja neulich hier schon aus anderem Anlass ein paar eigene Gedanken zum Problem – und das ist es zweifelsohne – notiert. Ich denke, Granzin schreibt von einem anderen Blickwinkel aus gesehen dasselbe in Grün.
Der Übersetzer kommt zu kurz. Schön. Wenn es um die Würdigung geht. Ich denke, ich habe in meinem Artikelchen klar gestellt, dass mir persönlich das eher schnuppe ist. Ich möchte das aber auf keinen Fall verallgemeinert sehen. Das Letzte, was ich wollte ist, einen namhaften Kollegen wie Frank Heibert, der für seine solide Übertragung eines namhaften Autoren gleich eine ganze Seite in der Zeit – oder wo auch immer – bekommt, mit keinem Wort gewürdigt zu sehen. Ich möchte aber auch nicht so weit gehen wie ein anderer Kollege, der lieber erst gar nicht erwähnt werden möchte »angesichts des niedrigen Niveaus, auf dem sich die heutige Literaturkritik bewege«. Autsch! Das ist mir zu elitär. Und es kann in seiner beleidigen Schärfe auch nur zum Letzten führen, was die Übersetzerei braucht: die Feindschaft des Rezensenten oder des Feuilletons überhaupt.
Die Übersetzer liegen ohnehin schon im Clinch mit den Verlagen; ein Zweifrontenkrieg ist das Letzte, was sie jetzt brauchen. Gerade weil – wie in der taz zu lesen – die ökonomische Situation der Rezensenten2 im Großen und Ganzen nicht viel besser als die der Übersetzer ist, sollte man an einem Strang ziehen. Mal angenommen, ein Rezensent haut in seiner Besprechung derart beleidigend zurück?
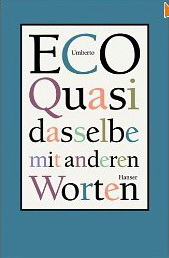
Und da liegt doch der Hase überhaupt im Pfeffer. Passen Sie auf:
Das Problem mit der Übersetzungskritik im Feuilleton ist zunächst einmal, dass es den weisen, gerechten Philosophenrezensenten, den sich die Kollegen hier offensichtlich ins Feuilleton denken, nicht gibt; einer, der souverän über den Disziplinen stehend gerecht gute Noten verteilt. Denn darum geht es doch, man will sich gelobt sehen. Kann man uns denn überhaupt kritisieren, so gut wie wir sind? Was wenn der erste Kollege verrissen wird, sei es mit einer Latte seiner tatsächlichen Fehler, sei es mit solchen, die er dem Lektorat verdankt, sei es mit solchen, bei denen der Rezensent sich irrt? Aber Lob hin, Verriss her, es muss doch jedem klar sein, dass der Rezensent die Arbeit des Übersetzers nicht noch mal machen kann. Wort für Wort. Und nur so ließe sich eine Übersetzung wirklich rezensieren. Andernfalls pickt sich der Rezensent eben Stellen heraus, bei denen er mitreden zu können meint, und das kann mal gut, mal ins Auge gehen. (Und ich sage das ausschließlich im Sinne von Katharina Granzins eingangs zitierten Maximen, nicht weil ich Rezensenten für doof halten würde.) Aber eines sollte jedem klar sein: Die Rezension wird immer interessanter ausfallen, wenn da einer in die Pfanne gehauen wird; Fehler finden ist einfach spannenderes Kino als eine Spalte Lobhudeleien: »Das ist gut, und auch das und das da und hier ist noch was – und das erst…« Sie sind doch jetzt auch einen Augenblick weggenickt, oder? Geben Sie’s zu.
Und ich lasse hier persönliche Witterungseinflüsse auf die jeweilige Rezension mal ganz außen vor.
Aber nehmen wir mal an, wir vermeiden den Krieg zwischen Übersetzer und Rezensent, den ich befürchte, wenn es zu Ausfällen gegen das »Niveau« des anderen kommt. Ich sehe in meinem Kristall noch weit Schlimmeres. Passen Sie auf:
Frank Heibert hat eine ganze Seite bekommen. Da hätte man ihn durchaus würdigen können; zumal wenn die Sprache ja offensichtlich gefallen hat. Ob eine tatsächliche Übersetzungskritik angebracht gewesen wäre, möchte ich nicht beurteilen. Aber, was ist mit all den anderen Rezensionen, die mit weit weniger Spalten auskommen müssen? Und was ist, wenn – weil es Mode geworden ist, in einer Übersetzungsrezension auch philologisch abzusondern – auch im letzten Hinweis auf eine Neuerscheinung noch rasch ein Satz kritisiert wird?
Hier wird herzlich unbedacht an einem schlafenden Riesen gerüttelt, der – einmal aufgewacht – in ein Volk von Übersetzungskritikern zerfallen wird, dessen Tun und Treiben nicht abzusehen ist, kommt es erst mal so richtig in Fahrt. Da hilft aber dann kein »Besen, Besen…« mehr.
So sehr ich mich freue, wenn meine Branche mal lobend herausgestellt wird, im Feuilleton scheint mir ein “gelungen” im Großen und Ganzen sinnvoller, und ein schlichtes “verunglückt” tut weniger weh.
_________________________________
Ich nehme Bezug auf einen Blogeintrag vom April. Nun möchte ich natürlich nicht behaupten, in der Liga der Namen mitstinken zu können, die in der taz genannt werden, meine aber, nach einem Vierteljahrhundert als Übersetzer durchaus mitreden zu können. Von meiner kleinen Warte aus.
- Der taz-Artikel befindet sich hier. [↩]
- Interessant (oder bedenklich), dass das bei den Übersetzerkollegen nicht zuerst mal ein Gefühl des Wiedererkennens und damit der Solidarität zu erzeugen scheint. Das ist meine Reaktion, wenn ich höre, es geht jemandem so lausig wie mir. [↩]
Dieser Beitrag hat 8 Kommentare
Ihre Ausführungen sind interessant. Für den uneingeweihten Literaturfreund ist das alles Neuland. Bitte meine Frage nicht despektierlich zu verstehen. Aber stellen Sie sich nicht auch selbst über das Feuilleton? Sie sagen doch auch, dass sie von der Kritik nicht beurteilt werden wollen.
MfG
Hinterfrager
Ganz und gar nicht. Seit ich Zeitung lese, schlage ich zuerst das Feuilleton auf. Man muss nicht immer einer Meinung mit den Leuten dort sein, aber ich habe Respekt vor ihnen. Sie befassen sich in der Regel gründlich mit der Facette eines Themas, von dem sie von Haus aus mehr Ahnung haben als ich.
Aber »Übersetzungskritik« beinhaltet einfach mehr als nur ein Urteil darüber, ob einem eine Übersetzung gefallen hat oder nicht. Mein Tenor ist der, dass der Rezensent die Übersetzung selbst für sich »nacharbeiten« müsste und eine Übersetzungskritik nicht auf einer Zeitungsseite abgehandelt werden könnte, auch nicht auf einer ganzen, was das Feuilleton einfach nicht zum richtigen Ort dafür macht.
Danke. Aber warum regt man sich unter der Übersetzerschaft dann so auf? Wenn man dem Artikel in der taz glauben darf, empfinden Ihre Kollegen die Situation als skandalös. Dass “die erbrachte Übersetzerleistung nicht wahrgenommen” wird scheint sie doch zu wurmen.
MfG
Hinterfrager
Ich spreche nicht für die Kollegen; ich habe oben nur zur Vorsicht zu mahnen versucht, was die Forderung nach Übersetzungskritik im Feuilleton anbelangt.
Ich kann nur soviel sagen, dass ein Unterschied darin besteht, seine Arbeit nicht mit seitenweise Übersetzungskritik gewürdigt zu sehen, und der Tatsache, dass man oft gar nicht erwähnt wird, nicht nur in Rezensionen – selbst in der Titelei von Büchern. Bei Hörbüchern scheint es noch öfter vorzukommen.
Es herrscht eine gewisse Unzufriedenheit darüber bei den Übersetzern.
Und das ist doch verständlich. Wenn Sie irgendwo ein Foto sehen, dann dürfen Sie sicher sein, dass darunter der Name des Fotografen bzw. der Agentur steht. Und bei Nichtnennung auf Schadenersatz zu klagen, ist kein Problem. Es wird als eine Art Diebstahl gewertet. Und das ist “nur” ein Foto. Wenn Ihr Name nicht auf Ihrer eigenen Übersetzung – Monate Arbeit! – steht oder falsch geschrieben wird, kriegen Sie ein’ in die hohle Hand. Im Prinzip wäre das Problem ja mit einer schlichten Besinnung auf den Anstand gelöst.
Der Übersetzer ist irgendwie ein störendes Glied in der Kette Autor-Verlag-Verlag-Leser. Ein geduldetes, weil unentbehrliches Übel. Man will in beiden Ländern den Autor verkaufen, nicht den Übersetzer.
Es ändert sich aber langsam etwas. Hin und wieder steht der Kollege ja bereits außen drauf. Wie weit der einzelne Kollege da nun gerne gehen würde, ist seine Sache.
Aber Sie schreiben doch, “man will sich gelobt sehen”. Spricht das nicht für einen gewissen Geltungsdrang?
Kirmes
Wie gesagt, hinter der Frustration der Übersetzer steckt ja das totale Ignoriert-werden. Und wenn ein Kollege auf einer ganzen Zeitungsseite zu einem von ihm übersetzten Werk nicht erwähnt wird, dann zeigt das ja seine »Unsichtbarkeit« in unserer Kultur, die sich doch auf Belesenheit, und dazu gehört nun einmal Weltliteratur, so viel einbildet. Denken Sie nur, mit welcher Verzweiflung die Leute die Listen mit den 100 besten Büchern kaufen. Aber es gehört eben zu dieser Kultur, eine wesentliche Schnittstelle im Entstehen von Weltliteratur – den Übersetzer – einfach zu übersehen.
Ich würde es nicht gleich als Geltungsdrang bezeichnen, wenn man als Glied in dieser Kette anerkannt werden will.
Das mit dem “Gelobt-werden-wollen” ist ein »logischer Sprung« in meinem Artikel. Es hätte da anders weitergehen müssen.
Aber wo ich es schon gesagt habe: Wenn man in Bezug auf eine eigene Arbeit nach Übersetzungskritik ruft, dann ja wohl nicht um das Buch um die Ohren zu kriegen. Man geht wohl davon aus, dass man es für größtenteils lobenswert hält. Aber wie gesagt, gehört eigentlich gar nicht rein hier, weil diese Frage jeder Übersetzer für sich beantworten muss.
“Anerkannt”. Als doch gelten wollen.
Anerkannt, zur Kenntnis genommen werden… ist für mich etwas anderes als “Geltungsdrang”; der Duden verweist von diesem auf “Geltungsbedürfnis” und definiert das als “Bedürfnis, angesehen zu sein und bei anderen etwas zu gelten”.
Sie müssen jeden einzelnen Kollegen fragen, wo er steht zwischen “gesehen werden” und “angesehen sein”.