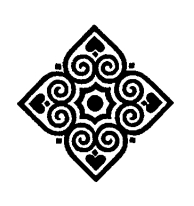Das den Essay leitende Prinzip, so schrieb Virginia Woolf 1922, sei »schlicht, dass er Vergnügen bereiten soll; und was ihn uns vom Regal nehmen lässt, ist schlicht der Wunsch nach Vergnügen«. Und dann spricht sie doch tatsächlich von der Beschleunigung der Zeit und den Veränderungen des Essays, die diese mitgebracht habe. Das klingt doch sehr nach einer Vorwegnahme unserer heutigen Zeit, in der Massenunterhalter wie Netflix und YouTube ihren Guckern den beschleunigten Konsum ihrer Serienware anbieten, in einer Zeit, in der, wie’s scheint, über jedem Artikel im Web der Zeitraum zu stehen hat, den der Leser für seine Lektüre benötigen wird.1 Was das mit dem Essay zu tun hat? Nun, ganz einfach, weiß man denn diese Form überhaupt noch zu goutieren in einer solchen Zeit?
Virginia Woolfs Essay über den Essay bzw. dessen jüngste Entwicklungen erschien in seiner ursprünglichen Form als Rezension einer fünfbändigen Anthologie von Essays mit dem Titel Modern English Essays 1870 to 19202), herausgegeben von einem Herrn Ernest Rhys. Lesen wir doch mal rein …
Virginia Woolf
The Modern Essay (1922)
Wie Herr Rhys so treffend sagt, ist es unnötig, tiefschürfend auf Geschichte und Ursprung des Essays einzugehen – ob er nun von Sokrates herstamme oder Siranney dem Perser3 –, da, wie bei allem, was lebt, seine Gegenwart wichtiger ist als seine Vergangenheit. Außerdem ist die Familie weit verbreitet; und während einige ihrer Vertreter in der Welt aufgestiegen sind, um ihre Krönchen mit den Besten zu tragen, fristen andere eine prekäre Existenz in der Gosse rund um die Fleet Street.4 Auch die Form erlaubt Vielfalt. Der Essay kann kurz sein oder lang, ernst oder belanglos, kann von Gott und Spinoza handeln oder von Schildkröten und Cheapside.5 Doch beim Durchblättern dieser fünf Bändchen mit Essays aus den Jahren 1870 bis 1920 erscheint einem das Chaos doch von gewissen Prinzipien regiert, sodass man in dem kurzen Zeitraum, mit dem sie befasst sind, so etwas wie das Fortschreiten der Geschichte erkennt.
Von allen literarischen Formen ist der Essay freilich diejenige, die am wenigsten nach langen Worten verlangt. Das ihn leitende Prinzip ist schlicht, dass er Vergnügen bereiten soll; und was ihn uns vom Regal nehmen lässt, ist schlicht der Wunsch nach Vergnügen. Alles in einem Essay hat sich diesem Ziel zu fügen. Er soll uns mit dem ersten Wort in seinen Bann ziehen, aus dem wir erst mit dem letzten Wort erfrischt wieder aufwachen sollen. Dazwischen erwarten uns die unterschiedlichsten Erfahrungen; wir können amüsiert sein, überrascht, gespannt oder gar empört; wir können uns mit Lamb6 in die Höhen der Phantasie erheben oder mit Bacon7 in die Tiefen der Weisheit stürzen, nur aufschrecken dürfen wir nicht. Der Essay muss uns überraschen und seinen Vorhang vor die Welt ziehen.
Ein so großes Kunststück sieht man selten vollbracht, wobei freilich der Fehler sowohl auf Seiten des Lesers als des Autors zu suchen sein mag. Gewohnheit und Lethargie haben seinen Gaumen stumpf werden lassen. Ein Roman hat eine Geschichte, ein Gedicht einen Reim; aber welche Kunst kann der Essayist in diesen kurzen Prosastücken anwenden, um uns hellwach zu machen und doch dabei in eine Trance zu versetzen, die kein Schlaf ist, sondern eher eine Intensivierung des Lebens – ein Bad in der Sonne des Vergnügens, alle unsere Anlagen und Fähigkeiten hellwach? Er muss wissen – das ist die wesentliche Voraussetzung – wie man schreibt. Seine Gelehrsamkeit mag so tief sein wie die eines Mark Pattison,8 aber in einem Essay hat sie durch die Magie des Schreibens dergestalt verschmolzen zu sein, dass kein Fakt hervorsticht, kein Dogma die Oberfläche der Textur zerreißt. Macaulay wie Froude9 haben dies, jeder auf seine ganz eigene Art, immer wieder auf hervorragende Weise gemacht. Sie haben uns in einem einzigen Essay mehr Wissen eingebläut als die unzähligen Kapitel von hundert Lehrbüchern. Wenn Mark Pattison uns jedoch auf fünfunddreißig kleinen Seiten von Montaigne erzählen muss, dann spüren wir, dass er es versäumt hat, sich vorher eingehend mit M. Grün10 zu befassen. M. Grün war ein Herr, der einmal ein schlechtes Buch geschrieben hat. Man hätte M. Grün und sein Buch zu unserer ewiglichen Wonne in Bernstein einbalsamieren sollen. Aber eine solche Beschäftigung ist ermüdend; sie erfordert mehr Zeit und vielleicht auch mehr Temperament, als Pattison zur Verfügung standen. Er servierte M. Grün roh und bleibt damit eine harte Beere in dem gegarten Fleisch, die unsere Zähne für immer beschäftigen wird. Etwas Ähnliches gilt für Matthew Arnold und einen gewissen Übersetzer von Spinoza. Wahrheiten wörtlich auszusprechen und einen Schuldigen zu seinem Besten zu tadeln, ist in einem Essay fehl am Platz, wo alles zu unserem eigenen Besten und eher für die Ewigkeit sein sollte als für die Märznummer der Fortnightly Review.11 Aber nicht nur die Stimme des Rüfflers sollte in diesem gedrängten Plot nie ertönen; es gibt noch eine andere, die einer Heuschreckenplage gleicht – die Stimme eines Mannes, der, sich ziellos an vage Ideen klammernd, im Halbschlaf zwischen losen Wörtern umherstolpert, etwa die Stimme von Mr. Hutton in der folgenden Passage:
Hinzu kommt, dass sein Eheleben sehr kurz war, nur sieben Jahre und ein Halt, als es ein unerwartetes Ende fand, und dass seine leidenschaftliche Verehrung für das Andenken und den Genius seiner Frau, die, seinen eigenen Worten nach »eine Religion« war, und die er, da er sich dessen vollkommen bewusst gewesen sein muss, in den Augen der übrigen Menschheit nicht anders als eine Extravaganz, um nicht zu sagen, als eine Halluzination zur Schau tragen konnte, und dass er dennoch von einem unwiderstehlichen Verlangen besessen war, sie in all den zärtlichen und enthusiastischen Hyperbeln verkörpern zu wollen, die es einem so erbärmlich erscheinen lassen, einen Mann, der seinen Ruhm durch sein »kaltes Licht« erlangte, als Meister zu sehen, und es ist unmöglich, sich des Gefühls zu erwehren, dass die menschlichen Begebnisse in Mr. Mills Karriere sehr traurig sind.12
Ein Buch könnte diesen Schlag verkraften, für einen Essay jedoch ist er tödlich. Eine zweibändige Biographie ist in der Tat das richtige Depot dafür, denn dort, wo der Spielraum um so Vieles größer ist und Andeutungen und Einblicke in nicht eigentlich zur Sache Gehörendes Teil des Festschmauses sind (wir beziehen uns auf den alten Typus des viktorianischen Bandes), fallen derartig ermüdende Längen kaum ins Gewicht und haben sogar einen positiven Eigenwert. Aber dieser Wert, den der Leser womöglich unstatthaft selbst beisteuert in seinem Wunsch, so viel als möglich aus allen nur möglichen Quellen in das Buch zu bekommen, ist hier auszuschließen.
In einem Essay ist kein Platz für die Unreinheiten der Literatur. Auf die eine oder andere Weise, sei es durch Arbeit, sei es durch die Großzügigkeit der Natur oder durch beides vereint, muss der Essay rein sein – rein wie Wasser oder rein wie Wein, auf jeden Fall rein von Stumpfsinn, Öde und belanglosem Sediment. Von allen Autoren des ersten Bandes gelingt Walter Pater13 diese anstrengende Aufgabe am besten, da er, noch vor der Niederschrift seines Essays (»Notizen über Leonardo da Vinci«) sein Material irgendwie zu verschmelzen vermochte. Er ist ein gelehrter Mann, aber es ist weniger das Wissen über Leonardo, das uns in Erinnerung bleibt als eine Vision, gleich der eines guten Romans, bei der alles dazu beiträgt, uns die Vorstellung des Autors als Ganzes nahezubringen. Nur hier, im Essay, wo die Grenzen so streng und die Tatsachen in ihrer Nacktheit zu verwenden sind, bringt ein wahrer Schriftsteller – und Walter Pater ist ein solcher – diese Beschränkungen dazu, ihre eigene Qualität zur Geltung zu bringen. Die Wahrheit verleiht ihm Autorität; aus ihren engen Grenzen gewinnt er Form und Intensität; und dann gibt es keinen passenden Platz mehr für so einiges von dem Zierrat, vom dem die alten Schriftsteller so angetan waren und die wir, indem wir sie als solchen bezeichnen, vermutlich verachten. Heutzutage hätte niemand mehr den Mut, sich in der einst berühmten Beschreibung von Leonardos Dame13 zu ergehen, die, in den Geheimnissen des Grabes erfahren, eine Taucherin in der Meere Tiefen gewesen sei, mit deren Tages Neige sie sich noch immer umgab; und die von orientalischen Kaufleuten fremdartige Gewebe erhandelt habe; und die wie Leda, die Mutter Helenas von Troja, gewesen sei und wie die Heilige Anna, die Mutter Marias …
Die Passage ist zu persönlich geprägt, um sich natürlich in den Kontext zu fügen. Aber wenn wir unerwartet auf »das Lächeln der Frauen und die Bewegung großer Gewässer«13 stoßen oder auf »voll von der Feinheit der Toten, in traurigen, erdfarbenen Gewändern, mit blassen Steinen besetzt«, erinnern wir uns plötzlich daran, dass wir Ohren und Augen haben und dass die englische Sprache eine lange Reihe von dicken Bänden mit unzähligen Wörtern füllt, von denen viele aus mehr als einer Silbe bestehen. Natürlich ist ein Gentleman polnischer Herkunft der einzige lebende Engländer,14 der je in diese Bände schaut. Aber zweifelsohne ersparen wir uns durch unsere Enthaltsamkeit viel Schwärmerei, viel Rhetorik, viel Hochtrabendes und Getänzel auf Wolken, und um der vorherrschenden sachlichen Nüchternheit willen sollten wir bereit sein, auf die Pracht von Sir Thomas Browne ebenso zu verzichten wie auf die robuste Art eines Swift.
Belassen wir es, mit Rücksicht auf heutige Sensibilitäten, für heute bei diesem ersten von drei Teilen, in die ich Woolfs Essay zerhackt habe. Ich weiß nicht, wie lange der müßige Leser, falls sich denn einer gefunden hat, für diese Seite gebraucht haben mag, aber ich hoffe doch, er hat es überstanden und harrt ungeduldig des zweiten Teils am kommenden Sonntag.
- um dann was zu tun? vermutlich für die Idioten, die im Kino beim letzten Dialog aufspringen, um, ja, wozu eigentlich — dumm in der Kneipe rumzustehen? [↩]
- 5 vols.; London and Toronto: J. M. Dent, 1922) (1850—1946 [↩]
- Wer »Siranney der Perser« oder »Siranez der Perser«, wie Rhys ihn nennt, war, scheint bis heute nicht geklärt. [↩]
- Lange Zeit das Zentrum des britischen Zeitungswesens, aber eben auch Zeitungsunwesens, weshalb Woolf von der »Gosse« spricht. [↩]
- Früher auch »The Cheap« ist eine Londoner Straße, die früher mal eine bekannte Einkaufsstraße, ja praktisch eines der Einkaufszentren von London war. »Gott und Spinoza« spielt an auf den Essay »Word about Spinoza« von Matthew Arnold im ersten Band von Rhys’ Anthologie; die »Schildkröten und Cheapsidc« nehmen Bezug auf »Ramblings in Cheapside« von Samuel Butler im selben Band. [↩]
- Charles Lamb (1775–1834) war ein englischer Dichter [↩]
- Der Philosoph, Jurist und Staatsmann Francis Bacon (1561–1626) war ein Zeitgenosse Shakespeares. [↩]
- Mark Pattison (1813–1884) war ein englischer Priester und Autor [↩]
- Thomas Babington Macaulay (1800–1859) war ein britischer Historiker, Dichter und Politiker; James Anthony Froude (1818–94) war ein englischer Historiker, Romancier und Herausgeber des Fraser’s Magazine. In seinem 1855 erschienenen Essay »Montaigne« behandelt Pattison Alphonse Grün’s Life of Montaigne. [↩]
- Alphonse Grün’s Life of Montaigne [↩]
- Die Fortnightly Review war Großbritanniens herausragendes Magazin des 19. Jahrhunderts. [↩]
- Aus »John Stuart Mill’s ‘Autobiography’« von Richard Holt Hutton (1826–97), ebenfalls im ersten Band der hier besprochenen Anthologie. [↩]
- * [↩] [↩] [↩]
- Sie spricht natürlich von Joseph Conrad, dem britischen Romancier polnischer Abstammung. [↩]