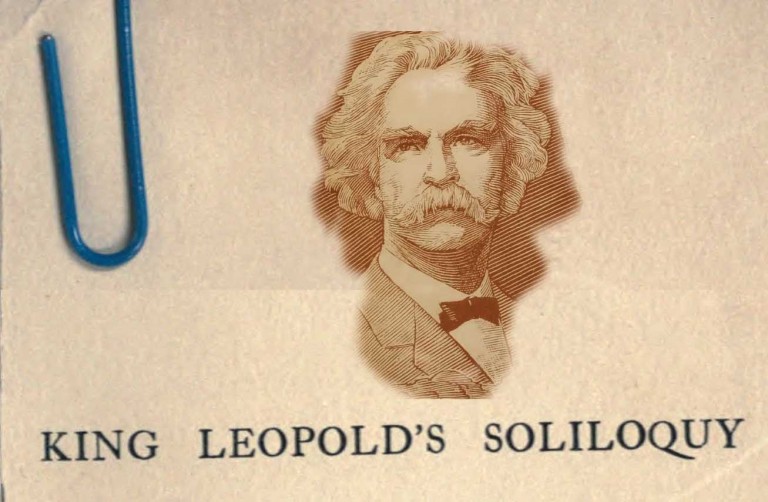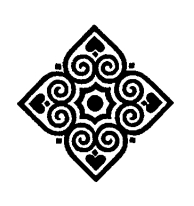Mark Twain brachte 1905 — mit all der ihm gemeinhin zugeschriebenen Naivität — sein Entsetzen über die ruchbar gewordenen Gräuel zum Ausdruck, die man im Namen des belgischen Königs Leopold II. im Kongo beging. Er tat dies in Form eines fiktiven Monologs, in dem der König seine Handlungsweise auf himmelschreiende Weise zu rechtfertigen versucht. Ich frage mich, ob sich nach diesem Muster nicht auch Satire auf Putin und Konsorten schreiben ließe — nicht weniger naiv, aber auch nicht weniger wirkungsvoll …
In diesem Abschnitt von Leopolds Soliloquium weidet der belgische König sich weiter an dem Umstand, dass die Amerikaner ihm, wenn auch unwissentlich, bei der Errichtung seines brutalen Sklavenstaats zur Hand gegangen sind. Ausgerechnet die »tugendhaften« Amerikaner! Hier scheint natürlich Twains eigene Ansicht über seine Landsleute durch.
Dann echauffiert der Potentat sich über die »Whistleblower« in Gestalt der Missionare, die weltweit über seine Gräuel berichteten. So verärgert wie verachtungsvoll zitiert er aus einem ihrer Pamphlete …
Mark Twain
König Leopolds Selbstgespräch
Eine Verteidigung seiner Herrschaft im Kongo
1905
in der Übersetzung von Bernhard Schmid © 20231
[Fortsetzung von hier]
Gut möglich, dass die Yankees das jetzt gerne zurücknehmen würden, aber sie werden feststellen, dass meine Leute nicht ohne Grund drüben in Amerika sind. Aber es besteht ohnehin keine Gefahr; weder Nationen noch Regierungen können es sich leisten, ihre Fehler einzugestehen. [Mit zufriedenem Lächeln macht er sich daran, aus einem Dokument mit dem Titel »Bericht von Rev. W. M. Morrison, amerikanischer Missionar im Kongo-Freistaat« vorzulesen]
»Ich lege hiermit einige der vielen entsetzlichen Vorfälle vor, von denen ich aus persönlicher Beobachtung Kenntnis habe; sie enthüllen das System organisierter Plünderung und Gräuel, das König Leopold von Belgien in diesem bedauernswerten Land eingeführt hat und bis auf den heutigen Tag unterhält. Ich sage König Leopold, weil er, und nur er, dafür verantwortlich ist, da er der absolute Souverän ist. Er bezeichnet sich selbst als solchen. Als unsere Regierung 1884 durch die Anerkennung seiner Flagge den Grundstein für den Freistaat Kongo legte, konnte sie nicht ahnen, dass es sich bei dieser Unternehmung, die unter dem Deckmantel der Philanthropie einherkam, in Wirklichkeit um König Leopold von Belgien handelte, einen der raffiniertesten, herzlosesten und gewissenlosesten Herrscher, die jemals auf einem Thron gesessen haben. Und das hat nichts zu tun mit seiner allenthalben ruchbar gewordenen moralischen Verderbtheit, durch die sein Name und seine Familie auf zwei Kontinenten zum Gegenstand der Verachtung geworden sind. Unsere Regierung hätte diese Flagge ganz sicher nicht anerkannt, hätte sie gewusst, dass es sich in Wirklichkeit um König Leopold handelte, der da um Anerkennung bat; hätte sie gewusst, dass sie im Herzen Afrikas eine absolute Monarchie errichtete; hätte sie gewusst, dass sie, die die Versklavung von Afrikanern in ihrem eigenen Land mit großem Aufwand an Blut und Geld abgeschafft hat, damit eine noch schlimmere Form der Sklaverei in Afrika selbst einführt.«
[Mit bösartiger Freude] Ja, da war ich wohl eine Spur zu schlau für die Yankees. Das schmerzt; das wurmt sie. Das können sie nicht verwinden! Und es beschämt sie noch auf eine andere, schwerwiegendere Weise; werden sie doch ihre Chroniken nie von dem Tadel befreien können, dass ihre eitle Republik, selbsternannte Fürsprecherin und Verfechterin aller Freiheiten dieser Welt, die einzige Demokratie der Geschichte ist, die ihre Macht und ihren Einfluss zur Errichtung einer absoluten Monarchie geltend gemacht hat!
[Beäugt mit unfreundlichem Blick einen stattlichen Stapel von Pamphleten] Hol sie der Teufel, diese lästigen Missionare! Zentnerweise schreiben sie derlei Zeug. Ständig scheinen sie in der Nähe zu sein, ständig am Spionieren, stets Augenzeugen allen und jeden Geschehens; und alles, was sie sehen, bringen sie zu Papier. Ständig streifen sie von Ort zu Ort; die Eingeborenen betrachten sie als ihre einzigen Freunde; sie laufen mit ihren Sorgen zu ihnen; sie zeigen ihnen ihre Narben und Wunden, die ihnen von meinen als Polizei eingesetzten Soldaten zugefügt wurden; sie halten die Stümpfe ihrer Arme hoch und klagen darüber, man habe ihnen die Hände abgehackt, als Strafe dafür, dass sie nicht genug Kautschuk beigebracht haben, und als meinen Offizieren vorzulegender Beweis dafür, dass die geforderte Strafe ordentlich und wahrhaftig vollzogen wurde. Einer dieser Missionare sah einundachtzig dieser Hände über einem Feuer trocknen, um sie meinen Beamten übergeben zu können – und natürlich musste er hergehen und alles zu Papier bringen und in Druck geben. Sie reisen und reisen, sie spionieren und spionieren! Und nichts ist zu belanglos für sie, um es zu drucken. [Nimmt ein Pamphlet zur Hand. Liest eine Passage aus dem Bericht über eine »Reise im Juli, August und September 1903 von Rev. A. E. Scrivener, ein britischer Missionar«]
» … Alsbald kamen wir ins Gespräch, und die Eingeborenen erzählten, ohne jede Aufforderung meinerseits, die Geschichten, die mir so vertraut geworden waren. Sie lebten in Ruhe und Frieden, als die Weißen vom See her kamen und allerlei Forderungen stellten, und sie wussten, was das bedeutete – Sklaverei. Also versuchten sie, die Weißen von ihrem Land fernzuhalten, aber ohne Erfolg. Den Gewehren waren sie nicht gewachsen. So fügten sie sich denn und beschlossen, aus den veränderten Umständen das Beste zu machen. Zuerst kam der Befehl, Häuser für die Soldaten zu bauen, dem man ohne Murren nachkam. Dann mussten sie die Soldaten und alle Männer und Frauen in deren Begleitung verpflegen. Dann befahl man ihnen, Kautschuk beizubringen. Das war etwas ganz Neues für sie. Es gab Kautschuk im Wald, einige Tage von ihrem Dort entfernt, aber dass er etwas wert war, das war ihnen neu. Als man ihnen eine kleine Belohnung bot, kam es zu einer Art Kautschukrausch. »Was für merkwürdige weiße Männer, die uns Stoffe und Perlen für den Saft einer wilden Ranke geben.« Sie freuten sich über ihr vermeintliches Glück. Doch bald sahen sie die Belohnung reduziert, bis man ihnen schließlich sagte, sie sollten den Kautschuk umsonst beibringen. Dagegen versuchte man sich zu sträuben; aber zu ihrer großen Überraschung erschossen die Soldaten einige von ihnen; die anderen sahen sich unter Flüchen und Schlägen aufgefordert, auf der Stelle zu gehen, andernfalls noch mehr von ihnen getötet würden. Zu Tode erschrocken, begannen sie, Lebensmittel für die vierzehntägige Abwesenheit von ihrem Dorf vorzubereiten, die zum Sammeln des Kautschuksafts nötig war. Als sie so dasaßen, sahen die Soldaten sie. »Was, ihr seid noch da?« Peng! Peng! Peng! und einer fiel tot um, dann ein weiterer, inmitten ihrer Frauen und Gefährten. Ein furchtbares Wehklagen hebt an, und man versucht, die Toten für die Beerdigung vorzubereiten, aber das wird ihnen verboten. Alle müssen sofort in den Wald. Ohne Nahrung? Ja, ohne Nahrung. Und die armen Teufel mussten sogar ohne ihre Zunderbüchsen zum Feuermachen losziehen. Viele starben im Wald an Hunger und Unterkühlung, und noch mehr durch die Gewehre der grausamen Soldaten, die für den Außenposten verantwortlich waren. Trotz aller Bemühungen ihrerseits ging die Ernte zurück und es wurden immer mehr von ihnen getötet. Man führte mich herum und zeigte mir, wo früher die großen Häuptlinge gewohnt hatten. Eine vorsichtige Schätzung bezifferte die Bevölkerung vor, sagen wir mal, sieben Jahren auf 2000 Seelen in und in einem Umkreis von etwa einer Viertelmeile um den Posten. Heute käme man nicht einmal mehr auf 200, und es herrscht so viel Traurigkeit und Niedergeschlagenheit, dass es rasch noch weniger werden.«
[Fortsetzung hier]