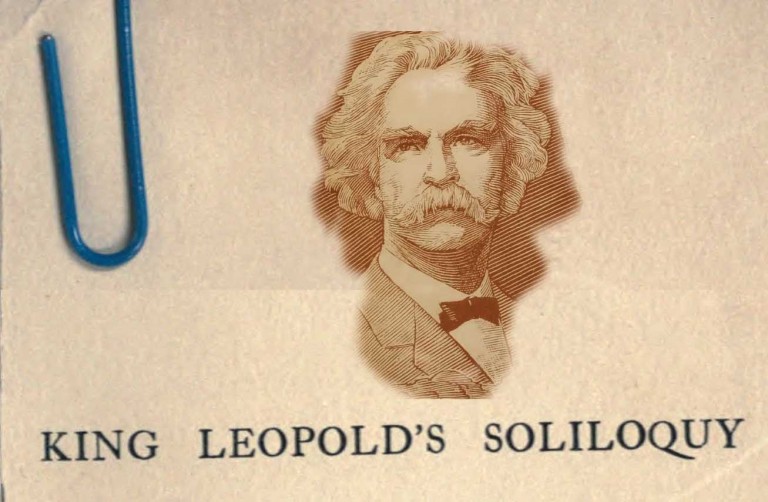Mark Twain brachte 1905 — mit all der ihm gemeinhin zugeschriebenen Naivität — sein Entsetzen über die ruchbar gewordenen Gräuel zum Ausdruck, die man im Namen des belgischen Königs Leopold II. im Kongo beging. Er tat dies in Form eines fiktiven Monologs, in dem der König seine Handlungsweise auf himmelschreiende Weise zu rechtfertigen versucht. Es handelt sich hier um ein Stück — durchaus brutaler — Satire, wie man sie heute, wie’s aussieht, leider kaum noch findet. Satiriker würden sich denn ja auch gleich von mindestens zwei Seiten kritisiert bis bedroht sehen …
In diesem siebten Teil von Twains bitterböser Satire bezeichnet sich der gute alte Leopold – wie heute der Donald – als politisch verfolgt; er spricht von einer ungerechtfertigten Hatz auf ihn. Stets laste man ihm die Fehler seiner Herrschaft an; niemand spreche von seinen guten Taten. Er wirft seinen Kritikern einen Mangel an Selbstachtung vor, sie wüssten schließlich ganz genau, dass seine brutalen Methoden nicht nötig wären, wenn es eine andere wirkungsvolle Methode gäbe, bei den Schwarzen einzutreiben, was ihm als Herr des Kongos zusteht. Und dann beklagt er den Gipfel der Verteufelung seiner Person: Man durchforste die Weltgeschichte nach Personen und Ereignissen, die seiner Schlechtigkeit gleichkommen, ohne fündig zu werden. Allein die Sintflut, so klagt er, komme ihm in den Augen dieser Lästerer gleich …
Mark Twain
König Leopolds Selbstgespräch
Eine Verteidigung seiner Herrschaft im Kongo
1905
in der Übersetzung von Bernhard Schmid © 20231
[Fortsetzung von hier]
Bei alledem verzichtet er geflissentlich auf den Hinweis, dass wir uns zur Geiselnahme gezwungen sehen, wollen wir das uns Geschuldete eintreiben, schließlich haben die Leute nichts, um zu zahlen. In die Wälder geflohene Familien verkaufen einige ihrer Angehörigen in die Sklaverei und sorgen so für das Lösegeld. Er weiß, dass ich dem ein Ende machen würde, ließe sich eine weniger anstößige Möglichkeit finden, das uns Geschuldete einzutreiben … Hmm – hier eine weitere Kostprobe von der Delikatesse des Herrn Konsul! Er berichtet von einem Gespräch, das er mit einigen Eingeborenen geführt haben will:
Frage: »Woher wisst ihr, dass die Grausamkeiten, die man euch angetan hat, vom weißen Mann angeordnet wurden? Das muss euch doch wohl von den schwarzen Soldaten ohne Wissen des weißen Mannes angetan worden sein.«
Antwort: »Die weißen Männer sagten ihren Soldaten: ›Ihr tötet nur Frauen; seid ihr nicht Manns genug, Männer zu töten. Ihr müsst beweisen, dass ihr Männer tötet.‹ Also haben die Soldaten, als sie uns töteten« (hier hielt er inne und zögerte, dann wies er auf … und fuhr fort:) »dann haben sie … und sie zu den weißen Männern gebracht, die darauf sagten: ›Es ist wahr, ihr habt Männer getötet.‹«
Frage: »Du sagst, dass das wahr ist? Wurden denn viele von euch so behandelt, nachdem man sie erschossen hatte?«
Alle [laut schreiend]: »Nkoto! Nkoto!« (»Sehr viele! Sehr viele!«)
Es bestand kein Zweifel daran, dass diese Menschen nichts erfanden. Ihre Vehemenz, ihre blitzenden Augen, ihre Aufregung waren nicht simuliert.«
Natürlich musste der Kritiker all das enthüllen; ihm fehlt jegliche Selbstachtung. Seinesgleichen machen mir Vorwürfe, obwohl sie ganz genau wissen, dass ich die Männer nicht zum Vergnügen auf diese Weise bestrafe, sondern nur als Warnung für andere Delinquenten. Gewöhnliche Strafen taugen nichts bei unwissenden Wilden; sie machen keinen Eindruck. [Liest weitere Abschnittsüberschriften]
»Region verwüstet; Bevölkerung von 40.000 auf 8.000 reduziert.«
Zu sagen, wie es dazu gekommen ist, das ist ihm die Mühe nicht wert. Ja, im Verschweigen ist er ganz groß. Er hofft, dass seine Leser und seine Kongo-Reformer vom Schlage Lord-Aberdeen-Norbury-John-Morley-Sir-Gilbert-Parker denken, dass die Leute alle getötet wurden. Das wurden sie nicht. Die große Mehrheit von ihnen entkam. Sie flohen vor den Kautschukeintreibern mit ihren Familien in den Busch und sind dort verhungert. Hätten wir das verhindern können?
Einer meiner trauernden Kritiker bemerkt: »Andere christliche Herrscher besteuern ihr Volk, stellen aber im Gegenzug dafür Schulen, Gerichte, Straßen, Licht, Wasser und Schutz für Leib und Leben; König Leopold besteuert seine geraubte Nation, gibt aber im Gegenzug dafür nichts als Hunger, Schrecken, Trauer, Schmach, Gefangenschaft, Verstümmelung und Massaker.« Das ist ihr Stil! Ich gebe »nichts«! Ich bringe den Überlebenden das Evangelium; diese anmaßenden Tadler wissen das, würden sich aber lieber die Zunge abschneiden lassen, als es zu erwähnen. Ich habe meine Soldaten mehrmals angewiesen, den Sterbenden Gelegenheit zu geben, das heilige Sinnbild zu küssen; und sofern sie gehorchten, war ich zweifellos das demütige Mittel zur Rettung vieler Seelen. Keiner meiner Verleumder war so fair, dies auch nur zu erwähnen; aber lassen wir das; es gibt Einen, der das nicht übersehen hat, und das tröstet mich, das ist mein Trost.
[Legt den Bericht beiseite, nimmt ein Pamphlet zur Hand, wirft einen Blick über den Mittelteil.]
Jetzt kommt das mit der »Todesfalle«. Ein zudringlicher Missionar, der dort herumspionierte – ein Rev. W. H. Sheppard. Spricht mit einem meiner schwarzen Soldaten nach einer Kommandoaktion; bekommt ihn dazu, einige Einzelheiten auszuplaudern. So sagt der Soldat:
»Ich forderte 30 Sklaven von dieser Seite des Flusses und 30 von der anderen Seite; 2 Elfenbeinspitzen, 2.500 Kugeln Kautschuk, 13 Ziegen, 10 Hühner und 6 Hunde, etwas Maismehl etc.«
»Wie kam es zu dem Kampf?«, fragte ich.
»Ich ließ alle ihre Häuptlinge, Unterhäuptlinge, Männer und Frauen, an einem bestimmten Tag zusammenkommen und sagte ihnen, dass ich dem ganzen Theater ein Ende machen würde. Als sie durch die kleinen Tore hier kamen (die Umfriedung bestand aus Zäunen, die man aus anderen Dörfern zusammengetragen hatte, von der hohen Sorte, wie sie bei den Eingeborenen üblich sind), verlangte ich alles, was mir zustand, sonst würde ich sie töten; sie weigerten sich, mich zu bezahlen, und so befahl ich, den Zaun zu schließen, damit sie nicht weglaufen konnten; dann töteten wir sie hier innerhalb des Zauns. Teile des Zauns fielen um und einige entkamen.«
»Wie viele habt ihr getötet?«, fragte ich.
»Wir haben viele getötet, willst du einige von ihnen sehen?«
Genau das wollte ich.
Er sagte: »Ich glaube, wir haben zwischen achtzig und neunzig getötet, und was die anderen Dörfer angeht, weiß ich nichts, ich bin da nicht selbst hin, ich habe meine Leute geschickt.«
Er und ich gingen hinaus auf die Ebene gleich neben dem Lager. Dort lagen drei Leichen, denen von der Taille abwärts das Fleisch von den Knochen tranchiert war.
»Warum hat man sie so zugerichtet, es sind nur noch die Knochen da?«, fragte ich.
»Meine Leute haben sie gegessen«, antwortete er prompt. Dann erklärte er: »Die Männer, die kleine Kinder haben, essen keine Menschen, aber alle anderen haben sie gegessen.« Auf der linken Seite lag ein großer Mann mit einer Schusswunde am Rücken und ohne Kopf. (Alle diese Leichen waren nackt.)
»Wo ist der Kopf des Mannes?«, fragte ich.
»Oh, sie haben aus der Stirn eine Schale gemacht, um darin Tabak und Haschisch zu zerreiben.
Wir setzten unsere Untersuchung bis zum späten Nachmittag fort und zählten einundvierzig Leichen. Der Rest war von den Leuten aufgegessen worden.
Als wir zum Lager zurückkehrten, kamen wir an einer jungen Frau vorbei, der man in den Hinterkopf geschossen und eine Hand abgetrennt hatte. Ich fragte warum, und Mulunba N’Cusa erklärte, dass sie immer die rechte Hand abtrennten, um sie bei ihrer Rückkehr dem Staat zu übergeben.
»Kannst du mir einige dieser Hände zeigen?«, fragte ich.
So führte er uns zu einem Gerüst aus Stäben, unter dem ein schwaches Feuer glomm, und da waren sie, die rechten Hände – ich zählte sie, einundachtzig insgesamt.
Es gab dort nicht weniger als sechzig gefangene Frauen (Bena Pianga). Ich habe sie selbst gesehen.
Wir sind uns einig, diese Ungeheuerlichkeit so vollständig wie möglich untersucht zu haben, und befinden, dass das im Voraus geplant war, um »so viel Zeug wie möglich zu bekommen« und die armen Leute dann in der ›Todesfalle‹ zu fangen und zu töten.«
Eine weitere Einzelheit, wie wir sehen! – Kannibalismus. davon berichten sie mit einer geradezu beleidigenden Häufigkeit. Meine Verleumder lassen keine Gelegenheit aus, darauf hinzuweisen, dass ich als absoluter Herrscher im Kongo mit einem Machtwort verhindern könnte, was zu verhindern mir genehm sei, sodass ich selbst verübe, was immer dort mit meiner Erlaubnis passiere, womit es ein ganz persönlicher Akt von mir sei; dass ich es verübe; dass die Hand meines Handlangers nicht weniger wahrhaftig meine eigene sei, als befände sie sich an meinem eigenen Arm; und so stellen sie sich mich im Staatsgewand vor, meine Krone auf dem Kopf, beim Mampfen von Menschenfleisch, ein Tischgebet auf den Lippen und ein gemurmeltes Dankeschön an Ihn, von dem alles Gute kommt. Oje, oje, diesen Weichherzigen braucht nur etwas wie der Beitrag dieses Missionars in die Hände zu fallen, schon ist es um ihre Seelenruhe geschehen. Sie beginnen gottlos zu lästern und machen dem Himmel Vorwürfe, dass er so einen Unmenschen leben lässt. Womit ich gemeint bin. Sie halten das für ungebührlich. Sie laufen zitternd umher und sinnieren über die Verringerung der Bevölkerung des Kongo von 25.000.000 auf 15.000.000 in den zwanzig Jahren meiner Regierungszeit; dann reißen sie den Mund auf und nennen mich »den König mit zehn Millionen Morden auf dem Gewissen«. Sie bezeichnen das als »Rekord«. Und die meisten von ihnen begnügen sich nicht damit, mir lediglich die 10.000.000 vorzuwerfen. Nein, sie denken, dass die Bevölkerung ohne mich sich durch natürliches Wachstum jetzt auf 30.000.000 belaufen würde, also rechnen sie mir weitere 5.000.000 an und erhöhen meine Todesbilanz auf 15.000.000. Sie meinen, dass der Mann, der die Gans tötete, die das goldene Ei gelegt hatte, auch für all die Eier verantwortlich gewesen sei, die sie später gelegt hätte, wenn man sie in Ruhe gelassen hätte. Oh ja, sie nennen mich einen »Rekord«. Sie weisen darauf hin, dass der Hunger in Indien zweimal pro Generation 2.000.000 von 320.000.000 Einwohnern vernichtet, worauf die ganze Welt vor Mitleid und Entsetzen die Hände wringt; dann fragen sie sich, wo die Welt wohl Platz für ihre Gefühle finden würde, hätte ich die Möglichkeit, zwanzig Jahre lang mit dem Hunger in Indien zu tauschen! Der Gedanke beflügelt ihre Phantasie derart, dass sie sich ausmalen, wie der Hunger nach Ablauf der zwanzig Jahre mit großem Zeremoniell zu mir kommt, sich vor mir niederwirft und sagt: »Lehre mich, oh Meister, ich sehe, dass ich nur ein Lehrling bin.« Und dann stellen sie sich vor, dass der Tod mit Sense und Stundenglas mich bitten kommt, doch seine Tochter zu heiraten, seinen Betrieb zu reorganisieren und das Geschäft zu führen. Und das weltweit, versteht ihr! Zu diesem Zeitpunkt befindet sich ihr fiebernder Verstand bereits in voller Fahrt, und sie holen ihre Bücher heraus und erhöhen ihre Anstrengungen, mit mir als Thema. Sie durchforsten sämtliche Biographien nach meinem Pendant, arbeiteten sich nach allen Regeln der Kunst durch Attila, Torquemada, Dschingis Khan, Iwan den Schrecklichen und Konsorten und brechen in bösartigen Jubel aus, wenn ihnen keines unterkommt. Dann nehmen sie sich die historischen Erdbeben und Wirbelstürme vor, die Schneestürme und Kataklysmen und Vulkanausbrüche: ihr Urteil, keiner von ihnen nimmt es mit mir auf. Und wenn sie es endlich geschafft zu haben meinen, schließen ihre Arbeit mit dem – wenn auch widerwilligen – Urteil, dass ich doch ein Pendant in der Geschichte habe, wenn auch nur eines – die Sintflut. Was maßlos überzogen ist.