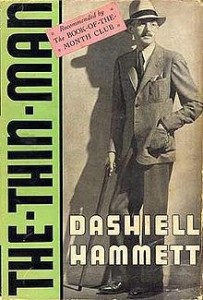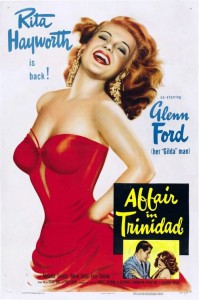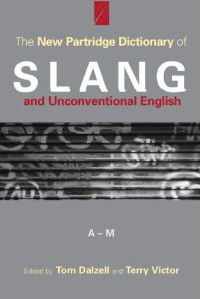McCarthy im falschen Ausschuss – unamerikanische Umtriebe
Wann immer wir heute den Namen McCarthy hören, kommt uns unweigerlich der schaurige Begriff »unamerikanische Umtriebe« in den Sinn – und umgekehrt. Der »McCarthyism und seine verhängnisvollen Folgen für Karriere und Leben zahlreicher Kreativer wurde – mit sicherem zeitlichen Abstand, versteht sich – in zahlreichen großen und kleinen Filmen thematisiert. Was hierzulande jedoch kaum jemand zu wissen scheint: Joe McCarthy hatte mit dem House Un-American Activities Committee, dem berüchtigten Ausschuss des Repräsentatenhauses gegen unamerikanische Umtriebe gar nichts zu tun.
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
Im April dieses Jahres legte der US-Senat unter dem Titel Wall Street and the Financial Crisis: Anatomy of a Financial Collapse den definitiven Bericht über die Finanzkrise 2008 vor. Was in der 635-seitigen Schwarte steht, weiß ich nicht, soll auch hier gar nicht interessieren, sondern nur dass ihn ein Gremium namens United States Senate Homeland Security Permanent Subcommittee on Investigations oder kurz Permanent Subcommittee on Investigations erarbeitet hat. Und genau diesem 1952 eingerichteten Ausschuss stand 1953/54 fünfzehn Monate lang der Senator aus Wisconsin Joseph McCarthy vor.
Auch wenn, wenigstens im Web, der eine oder andere McCarthy in den falschen Ausschuss steckt, für Amerikaner mit einem Minimum an Schulbildung liegt das Versehen auf der Hand: Joe McCarthy war Senator und hätte als solcher in einem Ausschuss des House of Representatives gar nichts verloren gehabt. (mehr …)