»Trümmlig« – die dritte…
Ich sehe langsam, ich habe mich etwas weit aus dem Fenster gelehnt mit meinen Betrachtungen* zu dem armen Wörtchen »trümmlig«. Anders gesagt, ich habe mich zum Idioten gemacht. Wäre ich…
Ich sehe langsam, ich habe mich etwas weit aus dem Fenster gelehnt mit meinen Betrachtungen* zu dem armen Wörtchen »trümmlig«. Anders gesagt, ich habe mich zum Idioten gemacht. Wäre ich…

Es geht um die paar in einer amerikanischen TV-Serie gesungenen Zeilen:
Hey, girl
What ya got for me
You want to get up on here
And have a baby with me, yeah
Die beiden Fragen im Forum dazu: (mehr …)
E.B. Tylor – Linguistische Aspekte des Slang (11)
Macmillan’s Magazine, Vol. XXIX (1873–74) pp. 502–513
Übersetzung © Bernhard Schmid
(Fortsetzung von)
*
Ein echtes englisches Slangwort chinesischen Ursprungs ist kotooing oder »performing the ko-too«. Jedermann weiß, dass to run a‑muck vom malaiischen amuk kommt; dass bosh türkisch für »leer« ist; dass chouse sich von einem gewissen türkischen chiaus, dem Gesandten, ableitet, der 1609 nach England kam und unsere Händler hereinlegte oder chiselled (prellte), wie wir heute sagen würden; und dass das Wort nabob, das einen reichen indischen Beamten im Ruhestand bezeichnet, vom arabischen nawáb kommt, das den Gouverneur einer Provinz bezeichnet. Weil ich gerade Arabisch erwähne, es ist recht merkwürdig, wie wenig Einfluss das Hebräische auf den englischen Slang gehabt hat. Die jüdischen Ärzte des Mittelalters, die Geldverleiher, Makler, Kaufleute und Altkleiderhändler seither haben auf unseren Straßen nur einige weniger Begriffe wie shoful oder show-full für falsches Geld bzw. ebensolchen Schmuck hinterlassen (Hebräisch, shafal, niedrig, gemein). Es steht fest, dass die Sprachen der nordamerikanischen Indianer fast ebenso viel zum englischen Slang beigetragen haben, schließlich sprechen wir mit großer Selbstverständlichkeit von einem pow-wow oder einer squaw; und das Straßenvolk kann die verzweifelte Lage erkennen, die man mit gone coon bezeichnet, ohne dass man ihm die Wendung erklärt. (mehr …)
Dass man im Englischen »Gesundheit!« sagt, wenn jemand niest, ist hierzulande sattsam bekannt – und übrigens seit Jahren laut Knigge bereits unhöflich, da man damit wohl ein »Gebrechen« seines Gegenüber zur Kenntnis nimmt. Und dass die Engländer den in Guernica geprobten deutschen »Blitzkrieg« nicht aus den Knochen bekommen, kann man verstehen. Ich meine mich noch zu erinnern, dass Boris Beckers Sieg in Wimbledon als »blitzkrieg« Schlagzeilen machte, was in der deutschen Presse Entrüstung hervorrief. Zu Unrecht, denn das Wort hat sich längst vom Zweiten Weltkrieg gelöst. Allerdings muss man sagen, dass es sich im Alltag nicht in Gänze gehalten, sondern als »blitz« überlebt hat. In dieser Form freilich ist es womöglich erfolgreicher als jeder andere deutsche Import. »Blitz« bezeichnet nicht nur jede Art von Attacke, etwa im American Football, sondern jede Art von hektischer Betriebsamkeit, mit der man etwas in Angriff nimmt. Googeln Sie nur mal nach »ad« oder »advertising blitz«. Im Guardian hieß es bereits 1960 mal: »The women did only the bare essentials of housework during the week with a ›blitz‹ at weekends.« Und selbst im aktuellen schwarzamerikanischen Slang findet man »blitz up on someone«, wenn jemand auf den anderen los geht, sei es physisch oder verbal. (mehr …)
Ich stoße im Web fast jeden Tag auf neue Wörter, nicht nur Neubildungen, sondern auch solche, die schon älter, aber eben mir unbekannt sind. In der Regel schlage ich sie nach, und die Sache ist mit einem Eintrag in meine Datenbank – zur fürderen Verwendung – erledigt. Hin und wieder ist aber auch eines interessant genug, um mich eingehender damit zu befassen. Schon gar wenn so ein Wort nicht im Duden steht. So ging es mir diese Woche mit trümmlig bzw. trümmelig. Auf der Suche nach Zitaten für ein ganz anderes Wort stand ich plötzlich in einem Schweizer Forum vor dem folgendem Satz:
Was bist du nur für ein “trümmliger” egoistischer Typ?
Der Duden hat es, wie schon angedeutet, nicht, dieses »trümmlig«. Weder in der einen noch in der anderen Variante. In meiner eigenen Datenbank für deutsche Umgangssprache finde ich lediglich trümmeln, was offensichtlich in Hamburg »rollen, wälzen« heißt. Das bringt mich erst mal nicht weiter. (mehr …)
E.B. Tylor – Linguistische Aspekte des Slang (9)
Macmillan’s Magazine, Vol. XXIX (1873–74) pp. 502–513
Übersetzung © Bernhard Schmid
(Fortsetzung von hier)
 So eng ist die Verwandtschaft zwischen dem englischen und anderen Dialekten der germanischen Sprachfamilie, dass der unbedachte Slangetymologe rasch einmal ein gutes altenglisches Wort für einen holländischen oder deutschen Import halten mag. Er wird dann das Diebswort für »stehlen« to nim (dem Corporal Nym seinen Namen verdankt) vom deutschen »nehmen« ableiten, wo es doch in Wirklichkeit direkt vom angelsächsischen niman (nehmen) kommt; desgleichen wird er das alte Cantwort cranke für die »Fallsucht« etc., von dem die Wendung »to counterfeit cranke« kommt, womit man die Vortäuschung epileptischer Anfälle bezeichnet, vom deutschen krank ableiten, wo es doch zweifelsohne ein gestandenes altenglisches Wort ist. In Fällen wie diesen ergibt sich die Verbindung zwischen englischen und hochdeutschen bzw. niederländischen Wörtern aus einer gemeinsamen Abstammung, nicht aus einer modernen Übernahme.
So eng ist die Verwandtschaft zwischen dem englischen und anderen Dialekten der germanischen Sprachfamilie, dass der unbedachte Slangetymologe rasch einmal ein gutes altenglisches Wort für einen holländischen oder deutschen Import halten mag. Er wird dann das Diebswort für »stehlen« to nim (dem Corporal Nym seinen Namen verdankt) vom deutschen »nehmen« ableiten, wo es doch in Wirklichkeit direkt vom angelsächsischen niman (nehmen) kommt; desgleichen wird er das alte Cantwort cranke für die »Fallsucht« etc., von dem die Wendung »to counterfeit cranke« kommt, womit man die Vortäuschung epileptischer Anfälle bezeichnet, vom deutschen krank ableiten, wo es doch zweifelsohne ein gestandenes altenglisches Wort ist. In Fällen wie diesen ergibt sich die Verbindung zwischen englischen und hochdeutschen bzw. niederländischen Wörtern aus einer gemeinsamen Abstammung, nicht aus einer modernen Übernahme.
Die tatsächlich aus dem Deutschen bzw. Niederländischen entlehnten Wörter, die während der letzten Jahrhunderte ihren Weg in den englischen Slang gefunden haben, vermitteln den Eindruck, als hätten unsere Soldaten sie im Krieg auf dem Kontinent und in holländischen Seehäfen aufgelesen. Ein Slangsatz wie »he left me without a stiver, but I didn’t care a rap« mag vielleicht die Erinnerung an die kleinen Münzen niederländischer und schweizer Währung einer Zeit erhalten, in der die Originale nur noch bei Altmetallhändlern und in Sammlervitrinen zu sehen sind. Wenn man bedenkt, wie Germanismen dieser Klasse England erreicht haben, braucht es uns nicht zu überraschen, dass viele von ihnen zwar durchaus lebendig, aber alles andere als achtbar sind. (mehr …)
– nein, nein, keine Sorge, das ist mitnichten ein Titel aus dem Nachlass von H. D. Thoreau.
Ein Waldspaziergang hat seine wohltuende Wirkung; ich bin schon seit Zeiten zu keinem mehr gekommen, aber ich meine mich zu erinnern… Dasselbe gilt wohl auch für Radfahren im Wald, Laufen im Wald, Kriechen, Krabbeln, Brandstiften… Nein, im Ernst, wenn man’s recht bedenkt, war dafür nie unbedingt ein spezieller Name nötig gewesen. Man geht spazieren, macht, was immer man zur Entspannung so macht, nur eben mal zufällig im Wald. Das wird sich jetzt bald ändern. Weil man jetzt bald zum »Waldbaden« gehen wird. Keine Bange, es kommt jetzt kein New Age-Vortrag; mich interessiert nur der Neologismus, die Neuprägung, das Wort an sich. (mehr …)
Wenn der Engländer sich zu echauffieren droht, hört er nicht selten: »Don’t get your knickers* in a twist!« – Was soviel heißt, wie Nun mach dir mal keinen Fleck ins Hemd! oder Reg dich nicht künstlich auf! Kein Grund zur Aufregung also. So recht zu verstehen ist die Wendung letztlich nur, wenn man sie auf ihre erotischen Ursprünge zurückverfolgt, denn die hier angesprochene Aufregung war zunächst rein sexueller Natur. Ebenso wie man sie nur auf Frauen angewandt fand. Und selbstverständlich gab es damals, wir sprechen von den 50er-Jahren, praktisch nur die guten alten Baumwollschlüpfer. Da gab es noch was zu verschieben, wollte man sich statt der Haare das Höschen raufen. Wie auch immer, das fügt sich doch alles zu einem anschaulichen Bild.
Aber so wie sich das Bild von der erotischen Erregung mit der Zeit auf die Aufregung bis zum Ärger verlegte, wandte man es immer öfter auch auf den Mann an, und schließlich gelangte das Bild auch in die Vereinigten Staaten. Wo daraus natürlich »Don’t get your panties in a bunch!” wurde. Außerdem entstanden immer neue Varianten der Wendung, die ihre Beliebtheit über den Schuss Ironie hinaus wohl auch einer nicht so recht definierbaren erotischen Anziehungskraft verdankt. Heute sind Anwendungsbeispiele natürlich leichter zu finden denn je. (mehr …)
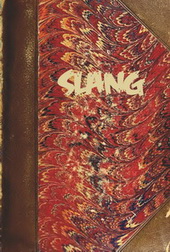 E.B. Tylor – Linguistische Aspekte des Slang (8)
E.B. Tylor – Linguistische Aspekte des Slang (8)
Macmillan’s Magazine, Vol. XXIX (1873–74) pp. 502–513
Übersetzung © Bernhard Schmid
(Fortsetzung von)
Der Strom des Französischen, der sich seit der Eroberung durch die Normannen ins Englische ergießt, hat unserem Slang, dem mittelalterlichen wie dem modernen, einige eigenartige Wörter beschert. So hören wir beim Kartenspielen und Würfeln heute noch die französischen Zahlwörter, die unsere Spieler sich vor langer Zeit ausgeborgt haben: ace, deuce, tray, cater, cinque, size. Quarrel-picker war früher eine allgemeine »Berufsschelte« für einen Glaser; der moderne Engländer müsste, um den Scherz zu verstehen, zurückgehen bis in die Zeit, in der das französische carreau für eine Glasscheibe noch in seiner älteren Form quarrel, in der wir es geborgt haben, im Gebrauch war. Das Wort vamp war zuerst Slang, und selbst zu Groses Zeit bedeutete es ganz allgemein, alte Hüte, Schuhe und dergleichen auszubessern oder aufzupolieren; danach fügte er hinzu »desgleichen neue Füße in alte Stiefel stecken«. Und zu dieser letzteren Bedeutung gehört der merkwürdige französische Ursprung des Wortes, wie in Mr. Wedgwoods Wörterbuch durch die Definition von Palsgrave belegt: »vampey of a hose, avant pied«. So war vamp zuerst das Oberleder eines Schuhes, und to vamp war Schusterjargon dafür, neues Oberleder aufzuziehen; es wurde im Lauf der Zeit zum anerkannten Wörterbuchwort dafür, alles und jedes zu renovieren. Captain Grose hat mehrere französische Wörter überliefert, die zum Slang seiner Zeit gehörten, seither aber außer Gebrauch gekommen sind. Einige davon sind nysey, einen Einfaltspinsel, von französische niais, ein hübsches Wort, das (von lateinisch nidus) ursprünglich einen ungefiederten Nestling bezeichnete; dann das nicht eben unappetitliche Wort hogo für den Geruch von verdorbenem Fleisch – »it has a confounded hogo« (französisch haut gout). Andere Wörter haben sich ihren Platz bewahrt. So ist etwa in Londons Hospitälern das Vorschützen von Krankheiten noch heute als malingering (französ. malingre) bekannt; und savey (französ. savez) ist gegenwärtig sowohl als Verbum als auch als Substantiv im Einsatz: »Do you savey that?« – “He has plenty of savey.« (mehr …)
 E.B. Tylor – Linguistische Aspekte des Slang (7)
E.B. Tylor – Linguistische Aspekte des Slang (7)
Macmillan’s Magazine, Vol. XXIX (1873–74) pp. 502–513
Übersetzung © Bernhard Schmid
(Fortsetzung von)
So manches Wort, dessen hohes Alter durch seine Überlieferung in der Literatur oder das nahezu gleichwertige Zeugnis seiner Verbreitung in regionalen Dialekten erwiesen ist, findet im Alter ein Zuhause und manchmal sogar eine Erneuerung seiner Jugend im Slangwörterbuch. So verhält es sich mit dem Verb to lift in seiner alten Bedeutung von stehlen; es ist aus dem modernen Gebrauch verschwunden und der guten Gesellschaft hauptsächlich durch Geschichten über die ausgestorbene Rasse der schottischen Grenzheroen bekannt, bei denen lifting sich auf den Diebstahl von Herden bezog. Das Diebesvolk der modernen Stadt jedoch behielt es in seinem Jargon. »There’s a clock been lifted« bedeutet laut Hotten, dass eine Uhr gestohlen wurde. Aus dem Slang der Diebe hat das Wort mit »shoplifting« zurück in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden; es bedeutet nun, unter dem Vorwand, etwas zu kaufen, von der Ladentheke zu stehlen.[1] (mehr …)
Was dem deutschen Sprachbewahrer der Anglizismus bzw. der englische Brocken im Hals, ist seinem britischen Gegenstück der Amerikanismus.
Anfang dieses Jahres haben die Briten sich über die hochherrliche, um nicht zu sagen imperialistische Art echauffiert, mit der Hackfleischmulti McDonald’s in einem Werbespot ihr geliebtes “quid” zum “bob” degradiert hatte. Der Spot wurde durch einen neuen ersetzt; das Problem schien gelöst.
Aber womöglich sind durch die Aufregung die Gemüter jetzt sensibilisiert. Jedenfalls brachte die Daily Mail in den letzten Tagen gleich zwei Artikel zum Thema sprachlicher Imperialismus der amerikanischen Art.
 Der Autor, Matthew Engel, beginnt mit dem – eher halbherzigen – Zugeständnis, dass Sprachen nun einmal wachsen, und einem historischen Rückblick darauf, dass bereits S.T. Coleridge 1832 das heute harmlos anmutende “talented” schockiert hatte, das eben aus den einstigen Kolonien nach England gekommen war. Sprachliche Übernahmen gehörten durchaus zum Alltag. Aber mit dem Auftauchen neuer Medien wie Film, Funk und Fernsehen seien die Importe aus Amerika ins Kraut geschossen, und jetzt drohte die schöne Muttersprache unter den hässlichen Amerikanismen zu ersticken. Engels Aufruf, der Flutwelle importierter Geistlosigkeiten den Krieg zu erklären, erinnert mich an die Nachricht, laut der die Briten gerade dem Problem fremdländischer Flora, die die heimische Tier- und Pflanzenwelt bedrohe, mit einer groß angelegten Ausreißaktion begegnen wollen. (mehr …)
Der Autor, Matthew Engel, beginnt mit dem – eher halbherzigen – Zugeständnis, dass Sprachen nun einmal wachsen, und einem historischen Rückblick darauf, dass bereits S.T. Coleridge 1832 das heute harmlos anmutende “talented” schockiert hatte, das eben aus den einstigen Kolonien nach England gekommen war. Sprachliche Übernahmen gehörten durchaus zum Alltag. Aber mit dem Auftauchen neuer Medien wie Film, Funk und Fernsehen seien die Importe aus Amerika ins Kraut geschossen, und jetzt drohte die schöne Muttersprache unter den hässlichen Amerikanismen zu ersticken. Engels Aufruf, der Flutwelle importierter Geistlosigkeiten den Krieg zu erklären, erinnert mich an die Nachricht, laut der die Briten gerade dem Problem fremdländischer Flora, die die heimische Tier- und Pflanzenwelt bedrohe, mit einer groß angelegten Ausreißaktion begegnen wollen. (mehr …)

Hin und wieder werde ich gefragt, ob ich mein American Slang nicht wieder mal überarbeiten möchte. Nun, möchten schon, aber wir sprechen hier von mehreren Jahren Arbeit, die einem dann leider sofort nach Erscheinen gestohlen – ich meine damit kopiert und ins Web gestellt – wird. Und wenn große Verlage das zunehmend davon abhält, Wörterbücher, ja überhaupt Nachschlagewerk herauszubringen, was soll ich da tun?
Interessant wäre in diesem Zusammenhang zu bemerken, dass mein Explicit Hiphop längst – ganz ohne weiteres Zutun meinerseits – zu einem Wörterbuch des zeitgenössischen Slang überhaupt geworden ist, in einigem Maße wenigstens; ich will damit sagen, dass ein Gutteil des Wortschatzes, der da unter Hiphop bzw. Rap aufgeführt wird, mittlerweile längst allgemeiner Slang ist. (mehr …)
Eines der Mädels hier im Forum hat mich auf etwas gebracht, was einen genaueren Blick wert ist, dass Schnodder eine prima Übersetzungsmöglicheit für das englische snot sein könnte. Die Gute hat das Wort nicht gekannt, und ich selber muss gestehen, ich habe es noch nie benutzt, weder privat, noch in einer Übersetzung. Ich nehme mal an, das liegt daran, dass Schnodder eher in Mittel- und Norddeutschland in Gebrauch ist.
Es hat nie großen Sinn, sich Gedanken über ein Wort zu machen, ohne sich erst einmal gründlich umzusehen. Also habe ich in meinen üblichen Anlaufstellen nachgeschlagen.
Küpper, der große Mann der deutschen Umgangssprache, hat dazu folgendes:
1. flüssiger Nasenschleim. Geht zurück auf mhd »snuder« und weiter auf das germ Wurzelwort von »Schnupfen«. Seit dem 15. Jh.
2. Schimpfwort. Eigentlich auf einen, der sich nicht die Nase putzt; von daher auch allgemein auf einen Unreinlichen. 1900 ff.
Küpper lässt sich nicht darüber aus, wo das Wort in Gebrauch ist. (mehr …)
E.B. Tylor – Linguistische Aspekte des Slang (6)
Macmillan’s Magazine, Vol. XXIX (1873–74) pp. 502–513
Übersetzung © Bernhard Schmid
(Fortsetzung von)
 Die Puristen, die Bewahrer eines reinen Englisch, tun ihr Möglichstes, die niederen Wörter, die der Slang hervorbringt, von der Sprache der Literatur und der feinen Gesellschaft fernzuhalten. Mit lobenswerter Strenge treten sie die linguistischen Paria zurück, wann immer sie, aus ihrer heimischen Gosse kommend, auf dem respektablen Gehsteig Fuß zu fassen sich bemühen. Der eine oder andere dieser gemeinen Eindringlinge erweist sich jedoch als stark genug, sich zu behaupten, während man es technischen Begriffen aus Handel und Handwerk und den erfundenen Wörtern modischer Plauderei, eine gewisse Toleranz übend, von Hause aus nicht so schwer macht. So haben donkey, conundrum und fun, heute fraglos allesamt ehrbare englische Wörter, als Slang das Licht der Welt erblickt; obwohl kein Etymologe bislang zweifelsfrei hat belegen können, wie sie entstanden sind. Keinen Zweifel dagegen gibt es bei drag, der heute allgemein üblichen Bezeichnung für einen gut ausgestatteten privaten Vierspänner; es handelt sich aber um einen Ausdruck des Cant, der, als solcher jedermann verständlich, eine Karre oder Kutsche bezeichnet; und dragsmen waren eine Art von Dieben, die Kutschen hinterherliefen, um das Gepäck hintenauf loszuschneiden. Von den Schuften, die das Stehlen von Kindern zum Gewerbe gemacht haben, hat die gute Gesellschaft das Wort dafür, nämlich to kidnap – i.e. to nab kids – entlehnt; was das Verbum to knab oder nab für wegnehmen anbelangt, (mehr …)
Die Puristen, die Bewahrer eines reinen Englisch, tun ihr Möglichstes, die niederen Wörter, die der Slang hervorbringt, von der Sprache der Literatur und der feinen Gesellschaft fernzuhalten. Mit lobenswerter Strenge treten sie die linguistischen Paria zurück, wann immer sie, aus ihrer heimischen Gosse kommend, auf dem respektablen Gehsteig Fuß zu fassen sich bemühen. Der eine oder andere dieser gemeinen Eindringlinge erweist sich jedoch als stark genug, sich zu behaupten, während man es technischen Begriffen aus Handel und Handwerk und den erfundenen Wörtern modischer Plauderei, eine gewisse Toleranz übend, von Hause aus nicht so schwer macht. So haben donkey, conundrum und fun, heute fraglos allesamt ehrbare englische Wörter, als Slang das Licht der Welt erblickt; obwohl kein Etymologe bislang zweifelsfrei hat belegen können, wie sie entstanden sind. Keinen Zweifel dagegen gibt es bei drag, der heute allgemein üblichen Bezeichnung für einen gut ausgestatteten privaten Vierspänner; es handelt sich aber um einen Ausdruck des Cant, der, als solcher jedermann verständlich, eine Karre oder Kutsche bezeichnet; und dragsmen waren eine Art von Dieben, die Kutschen hinterherliefen, um das Gepäck hintenauf loszuschneiden. Von den Schuften, die das Stehlen von Kindern zum Gewerbe gemacht haben, hat die gute Gesellschaft das Wort dafür, nämlich to kidnap – i.e. to nab kids – entlehnt; was das Verbum to knab oder nab für wegnehmen anbelangt, (mehr …)
Wer sich beruflich mit Sprache – zumal mit Umgangssprache – befasst, der weiß, dass man durchaus ins Schwitzen kommen kann, neuen Wörtern hinterher zu laufen. Umso dankbarer ist man für alle einschlägigen Hilfsmittel, schon gar die kostenlosen. Zwei davon möchte ich hier kurz vorstellen. Ich spreche von zwei Websites, die ich wenigstens einmal die Woche ansteuere, die eine englisch, die andere deutsch.
Bei der ersten, der englischen, handelt es sich um Paul McFedries’ Seite Wordspy. McFedries sammelt seit Jahren alles, was ihm an Neubildungen so unterkommt, und das ist so einiges. Und er bereitet seine Beute im Gegensatz zu ähnlichen Sites auf vorbildliche Weise auf. Wer jemals hinter neuen Wörtern her war, hat das womöglich vor Internetzeiten ähnlich gemacht wie ich, d.h. Time oder – die z.Z. zum Verkauf stehende – Newsweek abonniert, mit dem Textmarker gelesen, die neuen Sachen auf Karteikarten notiert, Zettelkasten geführt… War schließlich größtenteils auch noch die Zeit vor dem PC. (mehr …)
E.B. Tylor – Linguistische Aspekte des Slang (5)
Macmillan’s Magazine, Vol. XXIX (1873–74) pp. 502–513
Übersetzung © Bernhard Schmid
 Es lässt sich nicht vermeiden, dass der Schatz altehrwürdiger Scherze, wie er uns in Slangwörterbüchern erhalten ist, zuweilen trefflichen Anekdoten moderneren Datums im Wege steht. So verhält es sich mit folgender berühmten Passage aus Carlyles Life of Sterling: »Mir ist ein Beispiel für Sterlings Eloquenz zu Ohren gekommen, das uns auf den Schwingen schmunzelnden Hörensagens überliefert ist und augenscheinlich auf die eine oder andere Art auf den Konservatismus der Kirche anspielt: ›Haben sie nicht?‹ oder vielleicht auch ›Hat Sie (die Kirche) nicht‹ – ›einen schwarzen Dragoner in jeder Gemeinde, bei gutem Salär und ebensolcher Kost aus Ross- und Menschenfleisch, der dort Patrouille reitet und für derlei kämpft?‹« Durchaus wahrscheinlich, so bemerkt Carlyle, dass der schwarze Dragoner »begreiflicherweise die rundum junge Phantasie zu stürmischem Gelächter aufstachelte«; der Scherz jedoch war bereits etwas angestaubt, da bereits Grose, lange vor Sterlings Geburt, in seinem Slangwörterbuch »a review of the black cuirassiers« als »Heimsuchung durch die Geistlichkeit« definiert hatte. Dieselbe klassische Autorität (das Buch erschien 1785) übrigens, die Turkey merchant als Geflügelhändler* definiert. Ich muss es besseren Kennern der Vergangenheit überlassen, die Frage um die Wahrscheinlichkeit einer Anekdote zu klären, nach der dieser Scherz von dem (1736 geborenen) Horne Tooke stammt, den die Jungs bei seiner Ankunft in Eton die schreckliche Frage nach seinen Verhältnissen stellten: »Was macht denn dein Vater?« (mehr …)
Es lässt sich nicht vermeiden, dass der Schatz altehrwürdiger Scherze, wie er uns in Slangwörterbüchern erhalten ist, zuweilen trefflichen Anekdoten moderneren Datums im Wege steht. So verhält es sich mit folgender berühmten Passage aus Carlyles Life of Sterling: »Mir ist ein Beispiel für Sterlings Eloquenz zu Ohren gekommen, das uns auf den Schwingen schmunzelnden Hörensagens überliefert ist und augenscheinlich auf die eine oder andere Art auf den Konservatismus der Kirche anspielt: ›Haben sie nicht?‹ oder vielleicht auch ›Hat Sie (die Kirche) nicht‹ – ›einen schwarzen Dragoner in jeder Gemeinde, bei gutem Salär und ebensolcher Kost aus Ross- und Menschenfleisch, der dort Patrouille reitet und für derlei kämpft?‹« Durchaus wahrscheinlich, so bemerkt Carlyle, dass der schwarze Dragoner »begreiflicherweise die rundum junge Phantasie zu stürmischem Gelächter aufstachelte«; der Scherz jedoch war bereits etwas angestaubt, da bereits Grose, lange vor Sterlings Geburt, in seinem Slangwörterbuch »a review of the black cuirassiers« als »Heimsuchung durch die Geistlichkeit« definiert hatte. Dieselbe klassische Autorität (das Buch erschien 1785) übrigens, die Turkey merchant als Geflügelhändler* definiert. Ich muss es besseren Kennern der Vergangenheit überlassen, die Frage um die Wahrscheinlichkeit einer Anekdote zu klären, nach der dieser Scherz von dem (1736 geborenen) Horne Tooke stammt, den die Jungs bei seiner Ankunft in Eton die schreckliche Frage nach seinen Verhältnissen stellten: »Was macht denn dein Vater?« (mehr …)
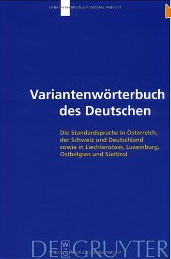 Ich bin ein großer Fan des DeGruyter Verlags. Ich wollte, ich könnte mir mehr DeGruyter-Titel leisten, allein um diesen Verlag zu unterstützen! Und ich hätte an jedem der Titel meine Freude. Dem Dornseiff. Dem Kluge…
Ich bin ein großer Fan des DeGruyter Verlags. Ich wollte, ich könnte mir mehr DeGruyter-Titel leisten, allein um diesen Verlag zu unterstützen! Und ich hätte an jedem der Titel meine Freude. Dem Dornseiff. Dem Kluge…
Wenn ich hier mal die Regale entlang gehe, sehe ich, dass List – ein Verlag der, seinen Übersetzungen nach zu urteilen, heute von Analphabeten geleitet wird – mal eine Taschenbuchreihe hatte. Neben dem List-Titel steht einer von Athenäum. Gibt’s den Verlag noch? Ein Epikur von Goldmann! (Mein alter Lateinlehrer hat mir das Büchl geschenkt!) Ein Urban-Taschenbuch usw. Ich denke mal, es ist keine allzu verwegene Behauptung, dass heute eine Menge Bücher, die zu lesen ein bisschen Hirnschmalz bedürfte, einfach nicht mehr gemacht werden. Und ich sage das als einer, der noch nicht mal mehr die Handlung von Winnetou I erzählen könnte. Will sagen als einer, der – seines lausigen Gedächtnisses wegen – wohl eine Menge Bücher umsonst gelesen hat. Suhrkamp ist auch nur noch ein Schatten seiner selbst. Alle sind sie verschwunden, DeGruyter hält die Stellung. Falls ich also mit diesem Blogartikel auch nur einen Käufer für DeGruyters Variantenwörterbuch des Deutschen werben kann… (mehr …)
E.B. Tylor – Linguistische Aspekte des Slang (4)
Macmillan’s Magazine, Vol. XXIX (1873–74) pp. 502–513
Übersetzung © Bernhard Schmid
Die Vermehrung des Wortschatzes durch Neubildungen und Wortänderungen, wie wir sie eben mit Beispielen belegt haben, ist jedoch im Slang – wie in anderen Spachzweigen auch – eher selten. Ein hundertmal effektiveres Mittel besteht darin, fertige Wörter zu nehmen und diese dann geschickt für neue Ideen zu adaptieren. Zu diesem Ende bedient der Slang sich ganz ungeniert der grammatischen Muster der Sprache ganz allgemein. Ein Pferd als prauncer zu bezeichnen (ein prigger of prauncers ist im Cant, der alten Gaunersprache, ein Pferdedieb), einen Fuß als trotter (französisch trottin), eine Feder als volante, einen Keks als cassant (im Sinne des modernen amerikanischen  cracker) und die Erde als the produisante belegt eine Methode der Wortbildung ganz nach Art des Sanskrit. In die andere Richtung ist diese Art der Wortbildung im Englischen noch aufschlussreicher, da sie uns im Geiste auf einen primitiven Zustand der Sprache zurückführt, in dem es kaum einen Unterschied gab zwischen ihren einzelnen Elementen und in dem noch jedes Wort zu konjugieren war; so steht etwa to knife für erstechen, war to fork out ursprünglich eine Art des Taschendiebstahls, bei dem man zwei gestreckte Finger wie eine Gabel in die Tasche des Opfers schiebt; to be cornered bedeutet in eine Ecke gedrängt, to be fullied voll und ganz dem Gericht überantwortet, to be county-courted heißt vorgeladen werden oder, um den präzisen Slangausdruck zu verwenden, summonsed, i.e. eine summons (Vorladung) des County Court zugestellt bekommen. Einige der von Adjektiven abgeleiteten Substantive im Slang sind durchaus treffend: hardy für einen Stein, flimsy für eine Banknote, milky ones für weiße Leintücher; im Französischen finden wir dure für Eisen, basse für die Erde, curieux für einen Richter und incommode für eine Laterne; das Italienische kennt dannoso (der bzw. die Gefährliche) für die Zunge, divoti (die Andächtigen) für die Knie und perpetua (die Ewigwährende) für die Seele. (mehr …)
cracker) und die Erde als the produisante belegt eine Methode der Wortbildung ganz nach Art des Sanskrit. In die andere Richtung ist diese Art der Wortbildung im Englischen noch aufschlussreicher, da sie uns im Geiste auf einen primitiven Zustand der Sprache zurückführt, in dem es kaum einen Unterschied gab zwischen ihren einzelnen Elementen und in dem noch jedes Wort zu konjugieren war; so steht etwa to knife für erstechen, war to fork out ursprünglich eine Art des Taschendiebstahls, bei dem man zwei gestreckte Finger wie eine Gabel in die Tasche des Opfers schiebt; to be cornered bedeutet in eine Ecke gedrängt, to be fullied voll und ganz dem Gericht überantwortet, to be county-courted heißt vorgeladen werden oder, um den präzisen Slangausdruck zu verwenden, summonsed, i.e. eine summons (Vorladung) des County Court zugestellt bekommen. Einige der von Adjektiven abgeleiteten Substantive im Slang sind durchaus treffend: hardy für einen Stein, flimsy für eine Banknote, milky ones für weiße Leintücher; im Französischen finden wir dure für Eisen, basse für die Erde, curieux für einen Richter und incommode für eine Laterne; das Italienische kennt dannoso (der bzw. die Gefährliche) für die Zunge, divoti (die Andächtigen) für die Knie und perpetua (die Ewigwährende) für die Seele. (mehr …)