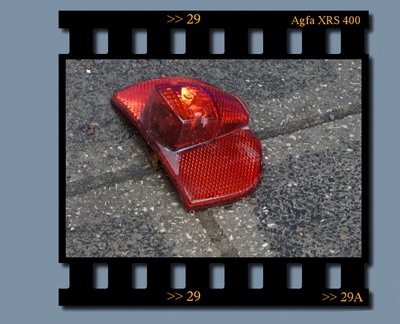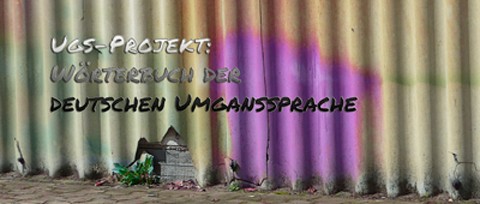Umfasst die Wörterbucheinträge für das Wörterbuch der deutschen Umgangssprache

Im Mosaik meiner Bemühungen, ein Bild dessen zu vermitteln, was wir – heute und historisch – als »Slang« bezeichnen, möchte ich hier eine der ersten Sammlungen vorstellen, die – nach englischem Vorbild – unter diesem Begriff für die deutsche Sprache zusammengetragen wurden. Die Einleitung dieser Sammlung ist ebenso interessant wie aufschlussreich. Sie ist außerdem einer der ersten Belege für die Anerkenntnis einer gesamtdeutschen Umgangssprache, an die wir im Augenblick, dank des Internets, in rasendem Tempo letzte Hand anzulegen scheinen. Ich persönlich nehme das Folgende als erstes Kapitel meiner Mission, mehr Umgangssprache aus allen deutschen Gegenden bei der Übersetzung aus Fremdsprachen zu verwenden.
Das Vorwort zu Arnold Genthes, Deutsches Slang habe ich bereits hier vorgestellt. Ich möchte im Laufe der nächsten Zeit die Sammlung selbst vorstellen. Interessant dabei ist, dass Genthe 1892 kaum ein Wort bzw. eine Wendung bringt, die wir nicht auch heute noch als solides Umgangsdeutsch bezeichnen würden. Um der Sammlung etwas mehr Gewicht zu geben, werde ich den einen oder anderen Eintrag durch einen Blick in andere Wörterbücher oder ins Internet ausführen bzw. kommentieren. (mehr …)

Im Mosaik meiner Bemühungen, ein Bild dessen zu vermitteln, was wir – heute und historisch – als »Slang« bezeichnen, möchte ich hier eine der ersten Sammlungen vorstellen, die – nach englischem Vorbild – unter diesem Begriff für die deutsche Sprache zusammengetragen wurden. Die Einleitung dieser Sammlung ist ebenso interessant wie aufschlussreich. Sie ist außerdem einer der ersten Belege für die Anerkenntnis einer gesamtdeutschen Umgangssprache, an die wir im Augenblick, dank des Internets, in rasendem Tempo letzte Hand anzulegen scheinen. Ich persönlich nehme das Folgende als erstes Kapitel meiner Mission, mehr Umgangssprache aus allen deutschen Gegenden bei der Übersetzung aus Fremdsprachen zu verwenden.
Das Vorwort zu Arnold Genthes, Deutsches Slang habe ich bereits hier vorgestellt. Ich möchte im Laufe der Zeit die Sammlung selbst vorstellen. Interessant dabei ist, dass Genthe 1892 kaum ein Wort bzw. eine Wendung bringt, die wir nicht auch heute noch als solides Umgangsdeutsch bezeichnen würden. Um der Sammlung etwas mehr Gewicht zu geben, werde ich den einen oder anderen Eintrag durch einen Blick in andere Wörterbücher oder ins Internet ausführen bzw. kommentieren. (mehr …)

Sie erinnern sich? Stets auf der Suche nach brauchbaren Wörtern und Wendungen aus allen Winkeln unserer deutschen Sprachlandschaft für unsere Übersetzungen. Der heutige Eintrag, so werden selbst die paar Dutzend aufgeklärter Zeitgenossen, die hier – mehr oder weniger genau – mitlesen, sich denken, wäre nun wirklich nicht nötig gewesen. Weil das Wort nichts mit Dialekt zu tun habe und es ein jeder kennt. Nun, das Wort hat zum einen mehr Bedeutungen als die, an die Sie im ersten Augenblick gedacht haben, zum anderen ist es wie kaum ein anderes Hafer für mein Steckenpferd…
Lassen wir mal Heinz Küppers erste Bedeutung für »Aufriß« – den »Streifschuß« (»Er reißt die Haut auf.«) – beiseite, der offenbar unter unseren Landsern im Zweiten Weltkrieg geläufig war. Nehmen wir die Bedeutung, an die Sie vermutlich als erste denken, wenn Sie das Wort »Aufriss« hören, nämlich die »Bekanntschaftsanknüpfung«, wie Küpper das gschamig nennt. Gerade diese Bedeutung macht »Aufriss« zu einem der Wörter, die, verlässt man sich auf Küppers Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, meine Forderung nach konsequenter worttechnischer Ausbeutung unserer heimischen Dialekte – heute würde man das vielleicht als »dialect mining« bezeichnen – besonders gut stützen.
Küpper nämlich setzt die Geburt des Wortes unter den Halbwüchsigen Österreichs der 1950er-Jahre an. (mehr …)
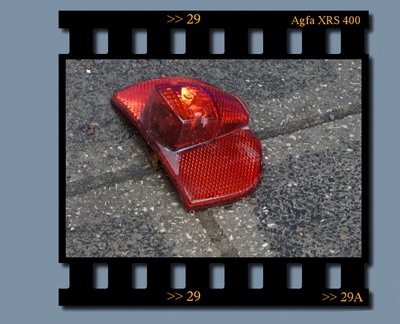
Sie erinnern sich? Stets auf der Suche nach brauchbaren Wörtern und Wendungen aus allen Winkeln unserer deutschen Sprachlandschaft für unsere Übersetzungen. Der heutige Eintrag, so werden selbst die paar Dutzend aufgeklärter Zeitgenossen, die hier – mehr oder weniger genau – mitlesen, sich denken, wäre nun wirklich nicht nötig gewesen. Weil das Wort nichts mit Dialekt zu tun habe und es ein jeder kennt. Nun, das Wort hat zum einen mehr Bedeutungen als die, an die Sie im ersten Augenblick gedacht haben, zum anderen ist es wie kaum ein anderes Hafer für mein Steckenpferd…
Lassen wir mal Heinz Küppers erste Bedeutung für »Aufriß« – den »Streifschuß« (»Er reißt die Haut auf.«) – beiseite, der offenbar unter unseren Landsern im Zweiten Weltkrieg geläufig war. Nehmen wir die Bedeutung, an die Sie vermutlich als erste denken, wenn Sie das Wort »Aufriss« hören, nämlich die »Bekanntschaftsanknüpfung«, wie Küpper das gschamig nennt. Gerade diese Bedeutung macht »Aufriss« zu einem der Wörter, die, verlässt man sich auf Küppers Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, meine Forderung nach konsequenter worttechnischer Ausbeutung unserer heimischen Dialekte – heute würde man das vielleicht als »dialect mining« bezeichnen – besonders gut stützen.
Küpper nämlich setzt die Geburt des Wortes unter den Halbwüchsigen Österreichs der 1950er-Jahre an. (mehr …)

Umgangsdeutsch für Übersetzer. Ein weiteres solides Wort der gesamtdeutschen Umgangssprache ist das Verb »ackern«. Und ich meine hier nicht die erste Definition »pflügen«, »mit dem Pflug bearbeiten« wie in dem Sprichwort »Mit ungleichen Pferden ist übel ackern.« Ich meine die Bedeutung »arbeiten«, mehr oder weniger hart: »Danach mußte sie als Antifalten-Creme-Model ackern oder erfolglose TV-Movies produzieren.« Und in dieser Bedeutung gehörte es meiner Ansicht nach auch in Übersetzungen. Ich habe es noch leider nie in einer gesehen. Aus SlangGuy’s Wörterbuch der deutschen Umgangssprache für Übersetzer
Nur der Gaudi halber, weil’s gar so schön klingt, die ursprüngliche Bedeutung vom guten alten Adelung Ende des 18. Jahrhunderts:
Ackern, verb. reg. act. von Acker. 1) Überhaupt so viel als pflügen. 2) Besonders, bey der Sommersaat, zum letzen Mahle pflügen, welches auch zur Saat pflügen, und saatfurchen, in der Mark Branderburg aber, in Ansehung der Gerstensaat, streichen, genannt wird. Das letzte Pflügen bey der Wintersaat wird dagegen an den meisten Orten ären genannt. 3) Bey den Kupferstechern bedeutet es die zur schwarzen Kunst bestimmte Platte mit der Wiege aufreißen, um hernach das Licht hinein zu schaben.
ackern
(1) <Vb.> Schwer / angestrengt / viel arbeiten; sich abmühen; oft aber auch nur synonym zu arbeiten. (mehr …)
Jeder im deutschen Sprachraum weiß, was ein »ganz ausgekochter Hund« ist. Ein rechter »Hundling« eben. Aber ein ganz »gefinkelter Bursche«? Um so einen zu kennen, musste man bislang, wie’s aussieht, ziemlich weit in den Süden, genauer gesagt nach Österreich. Obwohl die beiden Wörter von der Bedeutung her sich weit näher stehen, als man vermuten möchte. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen – und SlangGuy’s Wörterbuch der deutschen Umgangssprache.
Schlägt man »ausgekocht« im Duden nach, findet man Folgendes:
ausgekocht (ugs. abwertend): raffiniert, durchtrieben: ein ‑er Bursche, Gauner, Betrüger; wenn Sie es gewesen sind, sind Sie ein ganz ‑er Hund (Fallada, Blechnapf 289). (mehr …)
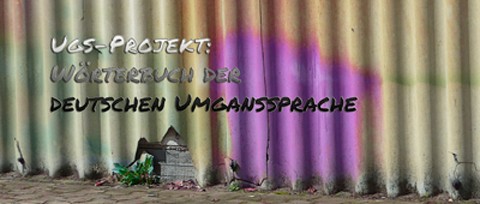
Den meisten von uns wird bei dem Wort »Schnulli« erst – oder nur – mal der »Schnuller« einfallen. Und selbst in dieser Bedeutung kennt man das »kleine, auf einer mit einem Ring versehenen Scheibe aus Plastik befestigte, einem Sauger ähnliche Bällchen aus Gummi, das Säuglingen [um sie zu beruhigen] in den Mund gesteckt wird«, sicher nicht in ganz Deutschland. Aber »Schnulli« hat noch weitere Bedeutungen, die sich gerade der Übersetzer genauer ansehen sollte…
Aber über den Schnuller, um den es hier gar nicht gehen soll, kann Ihnen die Wikipedia mehr erzählen. Oder, was seine linguistische Seite angeht, der Grimm:
schnuller, m. saugläppchen Schmeller 2, 576. Schmid 409. Sartorius 112. Klein prov.-wb. 2, 138: (der artigste junge,) der jemals kindsbrey gegessen und an einem schnuller gesuckelt hätte. Wieland 15, 157; schnuller, tabakspfeife Hartmann-Abele volksschausp. 597 (s. DWB schnullen). schnuller bezeichnet im hessischen penis Vilmar 364, vgl. DWB schnullen, harnen. Pfister erg. 2, 34 bezeugt für schnuller die bedeutung kaulquappe. (mehr …)
Dass man sich einen Bauch, eine Wampe oder einen Ranzen anfrisst, ist im ganzen deutschen Sprachraum bekannt. Und auch dass die Schnecken wieder mal den Salat angefressen haben. Und der Rost das schöne Chromteil am Oldtimer. Dass man auch als Mensch angefressen sein kein, schien mir bislang eher größtenteils im Süden, sagen wir mal in Österreich, allgemein geläufig zu sein. SlangGuy’s Wörterbuch der deutschen Umgangssprache
»Das sag ich dir als Freund, aber als Bulle bin ich ziemlich angefressen«, meinte gestern Wallner von der SOKO Rhein-Main zu seinem Kollegen Cem, der dem Team eine Zeugin vorenthalten hatte. Ausgestrahlt wurde die Sendung erstmals 2006. Nicht dass Frankfurt so furchtbar weit im Norden wäre, aber bisher hatte ich »angefressen« nur in südlichen SOKO-Reihen, vor allem in der Wiener, gehört. (Wo ist die eigentlich abgeblieben?)
Das Bild ist relativ klar. Der Grimm definiert folgendermaßen: (mehr …)
Luschen sind uns so geläufig wie die bereits neulich angesprochenen Gurken. Und beide sind im allgemeinen Sprachgebrach in etwa synonym. Und beide haben sie einen Abkömmling gemein, der nicht ganz so bekannt ist, ein Adjektiv auf die Endung –ig. Und auch die beiden Adjektive sind in etwa synonym. SlangGuy’s Wörterbuch der deutschen Umgangssprache.
Eine Lusche definierte sich zunächst als canis foemina, wie es im Grimm heißt, auf gut Deutsch ist das ein weiblicher Hund bzw. eine Hündin. Es ist damit ein Synonym zu Töle, Tiffe und Matz. Das was dem Angelsachsen seit je die heute global so geläufige bitch ist.
Im übertragenen Sinn wurde die Lusche bereits im 18. Jh. zur liederlichen Person, im späten 19. Jh. schließlich zum lausigen Kartenblatt und, wieder auf den Menschen angewandt, zum Versager. Von Letzterem leitet sich auch die wesentliche Bedeutung des Adjektivs luschig – von minderer Qualität – ab. (mehr …)
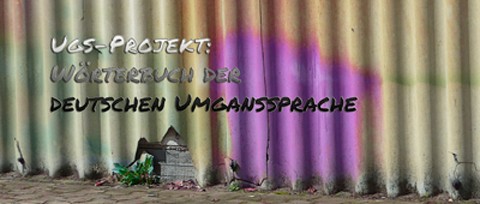
Das Fernsehen, insbesondere anno dunnemals die Übertragungen des Hamburger Ohnsorg-Theaters, war sicher nicht ganz unschuldig an der weiteren Verbreitung dieses putzigen niederdeutschen Adjektivs, das definitiv in den gesamtdeutschen Wortschatz aufgenommen gehört.
Bei Hafenkante und Großstadtrevier, so denke ich, habe ich es auch schon hin und wieder gehört. Tüddelig, tüttelig, tüdelig, tüddelich – wie man es auch schreiben mag, das Adjektiv gibt es in einer Reihe von Mundarten, wenn auch mit mehreren unterschiedlichen Bedeutungen. Ich habe jedoch den Eindruck, dass unter diesen die Bedeutung »wirr im Kopf« (siehe Bedeutung 1 im Folgenden) sich allgemein durchzusetzen begonnen hat. Hier wäre es interessant, wenn der eine oder andere Leser einen Kommentar dazu hinterließe, wie es sich damit in seiner Gegend verhält.
Besonders oft scheint man »tüttelig« – mehr oder weniger gutmütig – in der Bedeutung »wirr im Kopf« mit älteren Menschen in Verbindung zu bringen; man sagt dann, jemand sei »schon ganz tüddelig«; aber der Einfluss des Wetters tut es wohl auch, um vorübergehend tüttelig zu werden. (mehr …)
Die Gurke steht in der deutschen Umgangssprache für allerhand Minderwertiges. Der Duden definiert das mit »was nichts [mehr] taugt«. Wir bezeichnen Autos als müde oder alte Gurken, menschliche Gurken sind Unsympathen und Versager oder einfach dumm oder hässlich. Im Fußball ist schon mal von einem Gurkenspiel oder einer Gurkentruppe die Rede.
Aber davon später in einem eigenen Eintrag mehr. Desgleichen gilt für das offensichtlich ebenfalls noch gar nicht so alte Zeitwort »vergurken« für etwas verderben.
In den letzten Jahren hat sich zu »Gurke« mit »gurkig« ein Adjektiv herausgebildet, das die negativen Eigenschaften des Substantivs übernimmt. (mehr …)
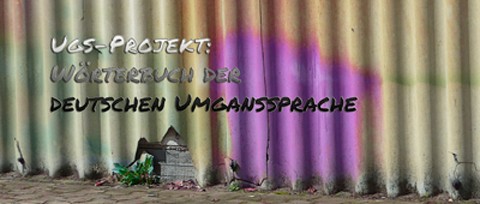
Wer sich ein bisschen umschaut im Supermarkt, hat sie vielleicht in den Grabbelkisten rumliegen sehen: Jerry Cotton im Taschenbuch, drei Romane in einem Band. Ein Beleg für die unverwüstliche Popularität der alten Heftchenserie. Was viele vielleicht nicht wissen ist, dass der »G‑man« auch für eine deutsche Redewendung gesorgt hat — oder wenigstens in Berlin.
Wenn ich »Trivialliteratur« höre, dann fällt mir merkwürdigerweise immer das dümmste Argument »gegen sie« ein, dass ich je gehört habe. Wir hatten im Deutschunterricht am Gymnasium seinerzeit ein schmales Heftchen mit dem Titel, so weit ich mich erinnere, Materialien zur Trivialliteratur. Und so lehrreich das nun auch gewesen sein mag, es enthielt auch so ziemlich den doofsten Satz, den ich je im Bereich der Literaturkritik gelesen habe. Sinngemäß lautete der: Jerry Cotton-Hefte können ja wohl nichts taugen, denn welcher deutsche Leser würde schon etwas mit einem Helden namens Jeremias Baumwolle lesen?
Ich schwör’s! (mehr …)

Die dritte Folge von SlangGuy’s Wörterbuch der deutschen Umgangssprache bedarf keiner großen Kommentare, da sie inhaltlich eng mit der zweiten – abasten – verbunden ist.
Für alle, die per Google erst mal hier gelandet sind, nochmal die Etymologie bzw. meine begründete einschlägige Vermutung:
… Allerdings findet sich auch ein weit direkterer Ahn, der auf den ersten Blick sinnvoller scheint, bei den Grimms: asten definiert man hier mit colere. Wer noch sein altes Lateinwörterbuch herumstehen hat, ist immer fein raus, aber das Internet tut es natürlich auch: colere: bestellen (einen Hof), bewirtschaften, bebauen etc. Da steckt sehr wohl bereits unsere heutige umgangssprachliche Bedeutung dahinter. Grimms Belege liefern den, ja, Beleg: einen hof asten und under handen han; guter die er nit selber astet oder buwet; hof zu Elma, den itzunt Clas Kalhart ast und bewet. Wir müssen das jetzt nicht im einzelnen ausklamüsern. (mehr …)

SlangGuy’s Wörterbuch der deutschen Umgangssprache: »sich einen abasten«. Auch einer der Einträge aus meinem alten Wiki-Versuch, deshalb gibt’s ein bisschen mehr – und vermutlich auch durchaus etwas Neues für den einen oder anderen. Da ich erst noch sehen muss, ob und wie das hier weitergeht, hat es auch noch keinen großen Sinn, mir zu überlegen, wie hier im Blog eine Wörterbuchseite anzulegen wäre, von der aus die Einträge alphabetisch einzusehen wären. Aber klicken Sie auf den Tag »Ugs-Wb« unten, dann dürften die bisher vorhandenen Einträge, wenn auch unsortiert, aufgelistet werden.
Kennen Sie den Astmann von Nôtre Dame? Nein? Das war Victor Hugos Glöckner mit dem »Ast«, der die schöne Esmeralda entführt. Im Rotwelschen nämlich ist der »Ast« der Buckel. Wenn man an die abgesägten Äste denkt, die man zuweilen als Höcker an Bäumen sieht, ist das ein durchaus enleuchtendes Bild. Ob die Bedeutung »Schulter, Rücken« daraus hervorging oder umgekehrt, ist hier nebensächlich, jedenfalls meint Küpper, hier eine mögliche Erklärung für das Verb abasten zu sehen. Mit anderen Worten, man schleppt etwas auf dem Rücken herum.
Möglich. (mehr …)

SlangGuy’s Wörterbuch der deutschen Umgangssprache … Nach der hoffentlich nicht zu vollmundigen Ankündigung von gestern soll auch schon mal ganz blauäugig und frei von der Leber weg losgelegt werden.
Unser erster Eintrag soll keineswegs den künftigen Ton angeben. Es handelt sich lediglich um einen von den aus meinem ersten Wiki-Anlauf übriggebliebenen Einträgen, und die will ich mal rasch abarbeiten, bevor sie noch mal verschütt gehen. Technisch gesehen ist dieser Eintrag aber doch wieder ein gutes Beispiel dafür, wo es hier langgehen soll: halbwegs aktuell, halbwegs systematisch, immer ein bisschen was, was andere nicht haben, ein bisschen gründlicher als andernorts, damit es dem Übersetzer auch tatsächlich nützt. Außerdem soll ruhig darauf hingewiesen werden, dass hier keine Rücksicht auf die »feineren Gefühle« oder gar irgendwelche »politisch korrekten« Maßgaben genommen werden kann. Wir würden uns heute weit leichter tun mit dem Verständnis vieler Wörter, hätten die Wörterbuchmacher nicht jahrhundertelang gewisse Bereiche der Sprache und damit des Lebens ausklammern müssen.
Was die Etymologie anbelangt, so wäre sie selbstverständlich im Idealfall mit dabei. Ist aber eine Menge Arbeit; sie ließe sich vielleicht in einem kleinen einführenden Artikelchen abhandeln, in dem auch sonst so einiges stehen könnte, was mir bei der Beschäftigung mit dem Wort so unterkommt. (mehr …)
Ein ganz und gar unwissenschaftliches Vorwort zu einem ganz und gar offenen Unterfangen, das ich hier im Blog starten möchte: Ein aktuelles Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. Völlig unprätentiös und nur…