Linguistische Aspekte des Slang (3)
 E.B. Tylor – Linguistische Aspekte des Slang (3)
E.B. Tylor – Linguistische Aspekte des Slang (3)
Macmillan’s Magazine, Vol. XXIX (1873–74) pp. 502–513
Übersetzung © Bernhard Schmid
Nach der direkten Lautmalerei und der Erfüllung durch sie entstandener Wörter mit neuer Bedeutung, geht Tyler auf weitere Möglichkeiten der Wortbildung ein.
Die Kürzung oder Kontraktion von Wörtern, ein äußerst wirkungsvolles Werkzeug bei der Entwicklung von Sprache, lässt sich im Slang ganz besonders gut verfolgen. So handelte es sich im Falle von cab – von cabriolet –, bus – von omnibus – und mob – von mobile vulgus, die »aufgewiegelte Volksmenge« –, ursprünglich um Slangbildungen, und eine erkleckliche Zahl von Wörtern harren in dieser ersten Lebensphase noch ihrer Beförderung, so etwa cure für curiosity, tench für penitentiary, sal for salary, rad for radical, rit for ritualist etc. Analog sind im Französischen démoc, soc, réac Kurzformen (mehr …)
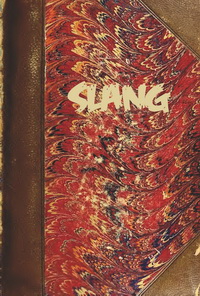




 Die Briten, jedenfalls die im Web vertretenen, ereifern sich seit Wochen über einen Werbespot, in dem ihnen Hackfleischriese MacDonald’s weismachen will, ein »pound« sei in der englischen Umgangssprache ein »bob«.
Die Briten, jedenfalls die im Web vertretenen, ereifern sich seit Wochen über einen Werbespot, in dem ihnen Hackfleischriese MacDonald’s weismachen will, ein »pound« sei in der englischen Umgangssprache ein »bob«. … die interessanteste Wendung, die man so googeln kann.
… die interessanteste Wendung, die man so googeln kann. Slang ist womöglich die einzige linguistische Kategorie, die gerne mal etwas blumiger definiert, ja, die oft lieber beschrieben wird als definiert. Vermutlich ist das eine Folge des Umstands, dass man von Anfang an Schwierigkeiten hatte, diese Erscheinung in die bestehenden Paradigmen einzuordnen. Bei einem Begriff wie »Dialekt« ist das kein Problem. Im Falle von Slang jedoch meinte zwar jeder zu wissen, was das ist, aber wenn es dann an eine sinnvolle Abgrenzung ging… Hier möchte ich eine schon etwas betagte Definition zitieren, bei der er einem geradezu leid tun könnte, der liebe Slang.
Slang ist womöglich die einzige linguistische Kategorie, die gerne mal etwas blumiger definiert, ja, die oft lieber beschrieben wird als definiert. Vermutlich ist das eine Folge des Umstands, dass man von Anfang an Schwierigkeiten hatte, diese Erscheinung in die bestehenden Paradigmen einzuordnen. Bei einem Begriff wie »Dialekt« ist das kein Problem. Im Falle von Slang jedoch meinte zwar jeder zu wissen, was das ist, aber wenn es dann an eine sinnvolle Abgrenzung ging… Hier möchte ich eine schon etwas betagte Definition zitieren, bei der er einem geradezu leid tun könnte, der liebe Slang.
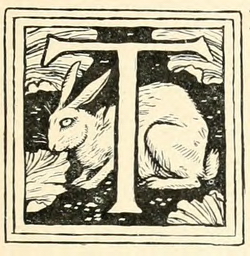 Vor ein paar Tagen sprach ich hier noch von den Bedeutungsänderungen, die einem Wort so widerfahren können. Jetzt, wo ich mir die Mühe mache, das – der ollen Fraktur wegen – nur unter ziemlichen Anstrengungen zu lesende Vorwort zu Fahrenkrügers Bailey fürs fürdere Studium abzutippen, finde ich gleich ein nettes Beispiel dafür. Fahrenkrüger erklärt im Vorwort den Gebrauch seines Dictionnaires
Vor ein paar Tagen sprach ich hier noch von den Bedeutungsänderungen, die einem Wort so widerfahren können. Jetzt, wo ich mir die Mühe mache, das – der ollen Fraktur wegen – nur unter ziemlichen Anstrengungen zu lesende Vorwort zu Fahrenkrügers Bailey fürs fürdere Studium abzutippen, finde ich gleich ein nettes Beispiel dafür. Fahrenkrüger erklärt im Vorwort den Gebrauch seines Dictionnaires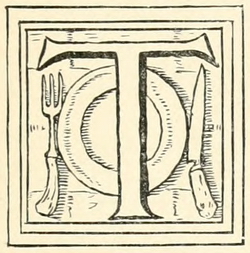 Will man ältere Texte korrekt übersetzen, so tut man gut daran, dabei auch ältere Wörterbücher und Lexika zu Rate zu ziehen, wenigstens nebenher, um sicher zu gehen. Wörter ändern gerne mal ihre Bedeutung, schon gar im Lauf von ein‑, zweihundert Jahren. So gehören ältere Dictionnaires einfach in die Wörterbuchsammlung des Übersetzerprofis. Und manchmal ist es auch ganz einfach lehrreich bis amüsant, einen Blick in das Vorwort so einer alten Schwarte zu werfen – trotz des optischen Kleinkriegs mit der Alten Schwabacher auf vergilbtem Papier.
Will man ältere Texte korrekt übersetzen, so tut man gut daran, dabei auch ältere Wörterbücher und Lexika zu Rate zu ziehen, wenigstens nebenher, um sicher zu gehen. Wörter ändern gerne mal ihre Bedeutung, schon gar im Lauf von ein‑, zweihundert Jahren. So gehören ältere Dictionnaires einfach in die Wörterbuchsammlung des Übersetzerprofis. Und manchmal ist es auch ganz einfach lehrreich bis amüsant, einen Blick in das Vorwort so einer alten Schwarte zu werfen – trotz des optischen Kleinkriegs mit der Alten Schwabacher auf vergilbtem Papier. Es ist ganz natürlich, die eigene Ära als eine allen anderen Zeiten weit überlegene zu sehen. Auf der anderen Seite ergibt sich daraus natürlich auch immer das Problem, dass man alles, was früher war, gern unterschätzt. Ich bin so ein Naivling, insofern es um Sprache geht. Jedenfalls muss ich das annehmen, weil ich immer wieder staune, wenn ich sprachliche Phänomene, die ach so neu scheinen, in einer anderen Zeit, in einem anderen Jahrhundert entdecke. Nehmen wir etwa das seit Jahrzehnten ins Kraut schießende Phänomen des „Schachtelworts“. Natürlich kennt man Lewis Carrolls Bildungen; und die sind nun über 100 Jahre alt. Und dennoch musste ich wieder einmal staunen, in dem im letzten Posting erwähnten Jahresband von Belford’s Monthly folgendes zu entdecken:
Es ist ganz natürlich, die eigene Ära als eine allen anderen Zeiten weit überlegene zu sehen. Auf der anderen Seite ergibt sich daraus natürlich auch immer das Problem, dass man alles, was früher war, gern unterschätzt. Ich bin so ein Naivling, insofern es um Sprache geht. Jedenfalls muss ich das annehmen, weil ich immer wieder staune, wenn ich sprachliche Phänomene, die ach so neu scheinen, in einer anderen Zeit, in einem anderen Jahrhundert entdecke. Nehmen wir etwa das seit Jahrzehnten ins Kraut schießende Phänomen des „Schachtelworts“. Natürlich kennt man Lewis Carrolls Bildungen; und die sind nun über 100 Jahre alt. Und dennoch musste ich wieder einmal staunen, in dem im letzten Posting erwähnten Jahresband von Belford’s Monthly folgendes zu entdecken: Da viele Wortneuschöpfungen, auch lausige wie „
Da viele Wortneuschöpfungen, auch lausige wie „ Gestern habe ich mir mit einiger Verspätung endlich den neuen „Szeneduden“ geleistet, das vom Trendbüro herausgegebene Wörterbuch der Szenesprachen. Ich bin ein großer Fan, letztlich schon seit dem Trendwörterbuch von Horx, das diese ebenso nützliche wie interessante „Reihe“ seinerzeit eingeleitet hat. Noch nicht mal einer wie ich, der selbst ständig in eigener Sache die Sprachfront rauf und runter hetzt, kann all die Neuschöpfungen in seiner Datenbank haben, die die völlig unübersichtliche Szenenlandschaft heute so prägen.
Gestern habe ich mir mit einiger Verspätung endlich den neuen „Szeneduden“ geleistet, das vom Trendbüro herausgegebene Wörterbuch der Szenesprachen. Ich bin ein großer Fan, letztlich schon seit dem Trendwörterbuch von Horx, das diese ebenso nützliche wie interessante „Reihe“ seinerzeit eingeleitet hat. Noch nicht mal einer wie ich, der selbst ständig in eigener Sache die Sprachfront rauf und runter hetzt, kann all die Neuschöpfungen in seiner Datenbank haben, die die völlig unübersichtliche Szenenlandschaft heute so prägen.