»The doggish way« oder vielleicht eher »doggedly« – verbissen allemal
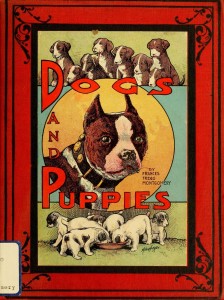 Als Übersetzer wie als Wörterbuchmacher durchsuche ich das Web nach Wörtern. Tagtäglich. Und praktisch den ganzen Tag. Entweder nach neuen Wörtern oder nach brauchbaren Anwendungsbelegen für solche, die ich bereits kenne. Ich stoße dabei stündlich auf Artikel der verschiedensten Sachgebiete, die ich am liebsten gleich lesen würde. Was natürlich nicht geht. Also begnüge ich mich mit dem für mich relevanten Satz und einem sauber gesetzten Lesezeichen – und komme meist doch bestenfalls wieder durch einen Zufall darauf zurück.
Als Übersetzer wie als Wörterbuchmacher durchsuche ich das Web nach Wörtern. Tagtäglich. Und praktisch den ganzen Tag. Entweder nach neuen Wörtern oder nach brauchbaren Anwendungsbelegen für solche, die ich bereits kenne. Ich stoße dabei stündlich auf Artikel der verschiedensten Sachgebiete, die ich am liebsten gleich lesen würde. Was natürlich nicht geht. Also begnüge ich mich mit dem für mich relevanten Satz und einem sauber gesetzten Lesezeichen – und komme meist doch bestenfalls wieder durch einen Zufall darauf zurück.
Aber einige lese ich natürlich auch gleich, und neulich bin ich auf einen – schon älteren – Essay gestoßen, der die Mühe allemal lohnt: Ludger Lütkehaus, »Die Tyrannei der Lust und die Kunst des Begehrens«. Lütkehaus formuliert anlässlich einer Buchrezension etwas aus, zu dem ich mir die letzten Jahre über selbst immer wieder mal meine Notizen gemacht habe, nämlich die Zwanghaftigkeit des heutigen Lustlebens und die dumpfe Brutalität dieses Zwangs. Nur dass er mir um zehn Jahre zuvor gekommen ist und dass er es mit Sätzen wie »Hedonismus als gestylter, buchstäblich eingefleischter Kadavergehorsam« besser formuliert, als ich das gekonnt hätte – und dass er mehr Ahnung vom psychologischen wie philosophischen Umfeld des Themas hat.
Nur einmal, auf meinem Gebiet, dem der englischen Sprache, vergaloppiert er sich, als er schreibt: »Doch was ist aus der ›Sache selbst‹ geworden, die nun einmal keine Sache ist? Gymnastische Ödnis, die in krudester Vorhersehbarkeit auf dem sexuellen Exerzierplatz den immergleichen Rhythmus vorführt: erstens Cunnilingus, zweitens Fellatio, drittens das Reiterchen, viertens ›let’s do it the doggish way‹.« (mehr …)




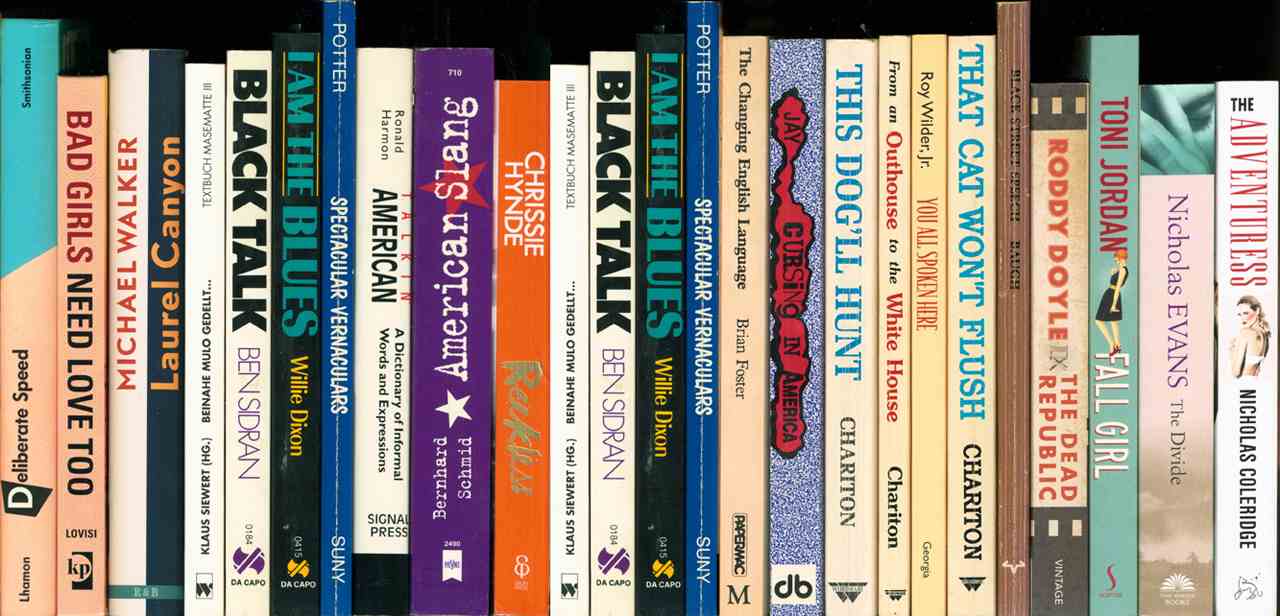






 Gestern habe ich mir mit einiger Verspätung endlich den neuen „Szeneduden“ geleistet, das vom Trendbüro herausgegebene Wörterbuch der Szenesprachen. Ich bin ein großer Fan, letztlich schon seit dem Trendwörterbuch von Horx, das diese ebenso nützliche wie interessante „Reihe“ seinerzeit eingeleitet hat. Noch nicht mal einer wie ich, der selbst ständig in eigener Sache die Sprachfront rauf und runter hetzt, kann all die Neuschöpfungen in seiner Datenbank haben, die die völlig unübersichtliche Szenenlandschaft heute so prägen.
Gestern habe ich mir mit einiger Verspätung endlich den neuen „Szeneduden“ geleistet, das vom Trendbüro herausgegebene Wörterbuch der Szenesprachen. Ich bin ein großer Fan, letztlich schon seit dem Trendwörterbuch von Horx, das diese ebenso nützliche wie interessante „Reihe“ seinerzeit eingeleitet hat. Noch nicht mal einer wie ich, der selbst ständig in eigener Sache die Sprachfront rauf und runter hetzt, kann all die Neuschöpfungen in seiner Datenbank haben, die die völlig unübersichtliche Szenenlandschaft heute so prägen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass man in Übersetzungen aus dem Englischen selten, wenn überhaupt jemals etwas spürt? Ich meine, dass etwas „gespürt“ wird? Was immer man körperlich empfindet oder wahrnimmt, es wird immer nur „gefühlt“. Und wieder einmal hat das einen ganz einfachen Grund: Die bloße morphologische Ähnlichkeit des englischen Ausgangswortes mit irgendeinem deutschen Zielwort schließt bereits den Gedanken an andere Übersetzungsmöglichkeiten kurz und damit aus.
Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass man in Übersetzungen aus dem Englischen selten, wenn überhaupt jemals etwas spürt? Ich meine, dass etwas „gespürt“ wird? Was immer man körperlich empfindet oder wahrnimmt, es wird immer nur „gefühlt“. Und wieder einmal hat das einen ganz einfachen Grund: Die bloße morphologische Ähnlichkeit des englischen Ausgangswortes mit irgendeinem deutschen Zielwort schließt bereits den Gedanken an andere Übersetzungsmöglichkeiten kurz und damit aus. 
 Wenn ich diese Wendung höre, dann bekomme ich erst mal so einen Hals, weil ich das englische Original – what’s your opinion – dahinter höre und eine wörtliche Übersetzung vermute, die… nun ja, bei sowas kriege ich nunmal einen Hals.
Wenn ich diese Wendung höre, dann bekomme ich erst mal so einen Hals, weil ich das englische Original – what’s your opinion – dahinter höre und eine wörtliche Übersetzung vermute, die… nun ja, bei sowas kriege ich nunmal einen Hals.