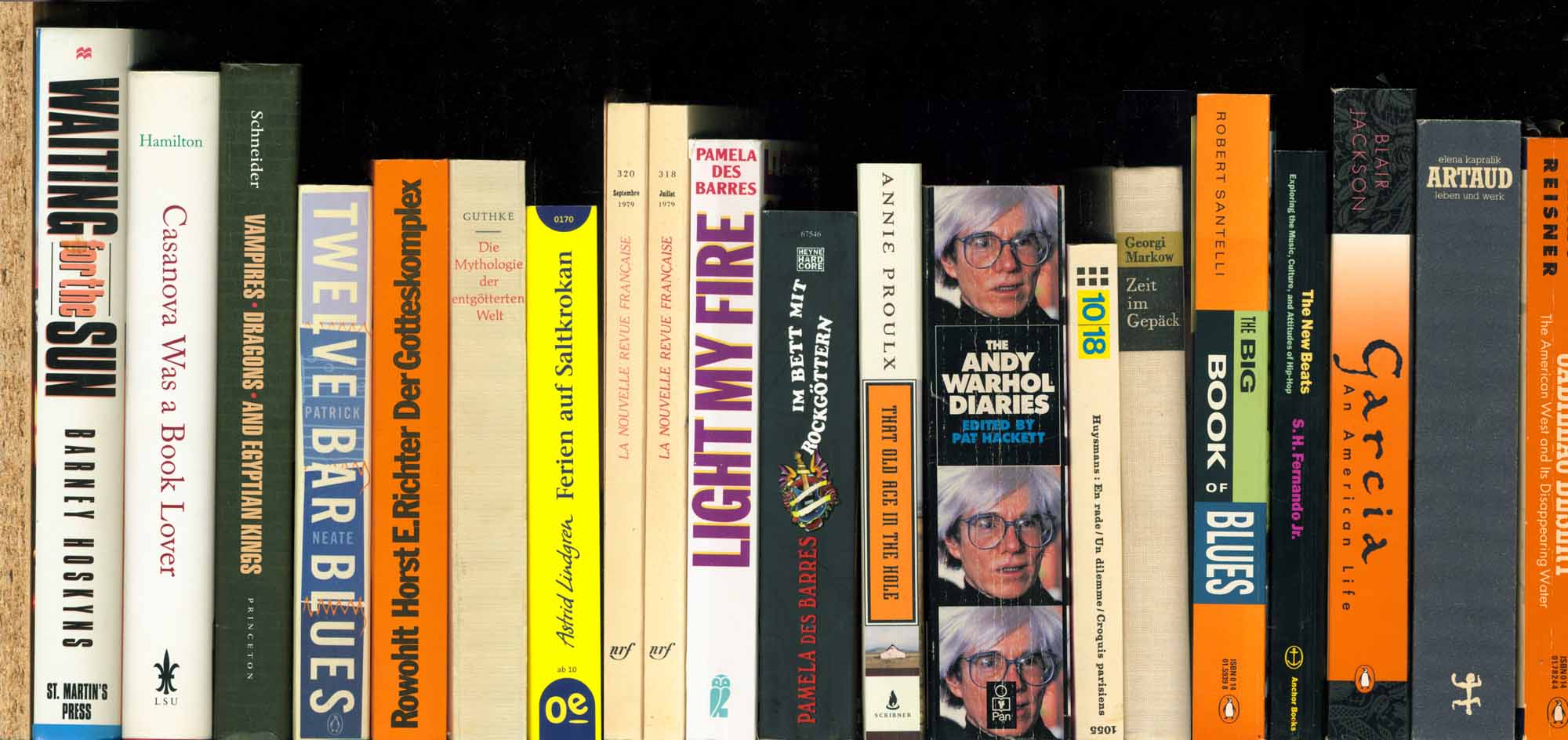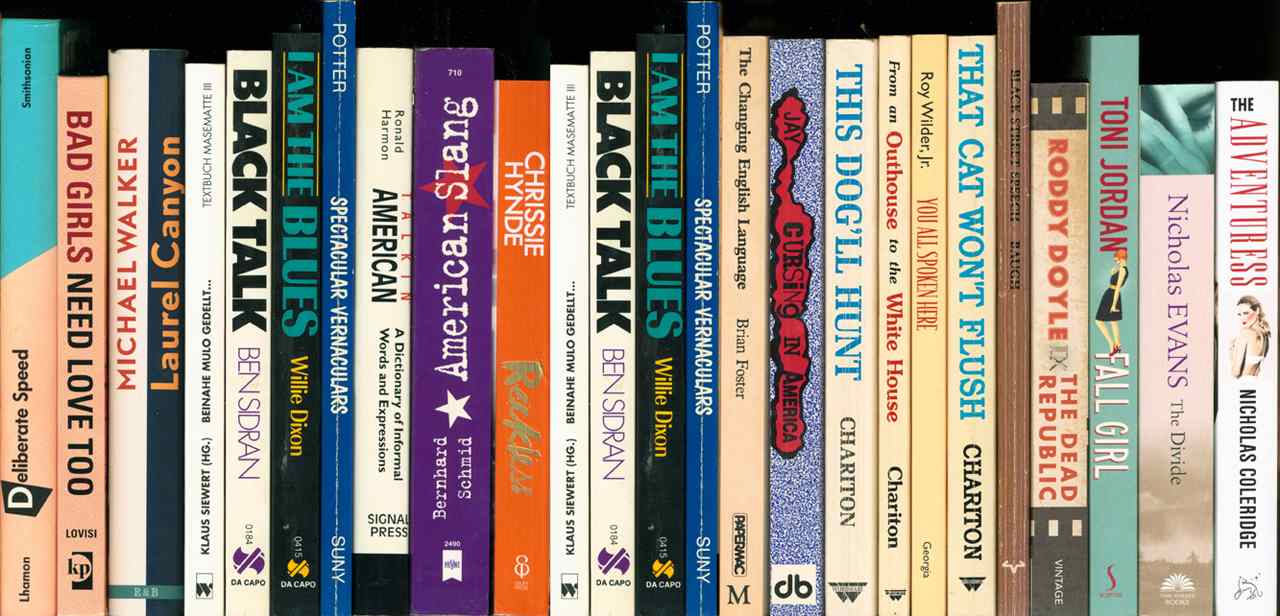Übersetzen – schon beim Motto fängt es an
Der Leser einer Übersetzung ahnt in der Regel nichts von den kleinen und größeren Problemen, die eine solche mit sich bringt. Etwa dass der Übersetzer, stößt er im Ausgangstext auf ein Zitat, nachschlagen muss, ob das bereits mal übersetzt wurde, und diese Übersetzung dann aufzutreiben hat. Was wiederum seine eigenen Probleme mit sich bringt; ganz zu schweigen davon, dass es Zeit kostet. Aber das gehört eben dazu. Nervig wird es freilich, wenn die nach einigem Suchen aufgetriebene Übersetzung den gesuchten Satz nur halb enthält oder gar nicht. Oder der Satz partout nicht in den Kontext passen will, selbst wenn er nicht falsch übersetzt ist, oder wenn er falsch übersetzt ist, was noch mehr fuchst.
Sean Wilentz stellt seinem Buch Dylan in America ein Zitat von Walt Whitman voran: »Only a few hints – a few diffused, faint clues and indirections…« Die Zeile ist aus dem Gedicht »When I read the book«, und das gemeinte Buch ist eine Biographie. Whitman stellt die Frage, was einem die Biographie eines anderen wirklich zu sagen vermag? Wo doch so offensichtlich Zweifel daran bestehen, ob man selbst so viel über sein Leben weiß.
WHEN I READ THE BOOK.
WHEN I read the book, the biography famous,
And is this then (said I) what the author calls a man’s life?
And so will some one when I am dead and gone write my life?
(As if any man really knew aught of my life,
Why even I myself I often think know little or nothing of my real life,
Only a few hints, a few diffused faint clews and indirections
I seek for my own use to trace out here.)
Nun, ich habe nur ein altes Bändchen hier stehen, was Whitman auf Deutsch anbelangt: die von Wilhelm Schölermann ausgewählte und übertragene Sammlung Grashalme aus dem Jahre 1904.1 Und Schölermann macht aus dem Gedicht folgendes: (mehr …)
- Verlegt bei Eugen Diedrichs Leipzig. [↩]