»May have been« möglicherweise…
 … die interessanteste Wendung, die man so googeln kann.
… die interessanteste Wendung, die man so googeln kann.
Ich arbeite im Augenblick mit dem Sohn eines alten Freundes aufs nahende Englischabitur hin. Anders als bei der Arbeit an meinem Wörterbuchprojekt British Slang gibt mir das die Gelegenheit, im Web nach Beispielen für bestimmte Grammatikprobleme zu suchen. Und so habe ich denn, um die Wendung »may have been« einzuüben, selbige mal in Google eingegeben. Bei 200.000.000 Fundstellen hat die Suchmaschine zu zählen aufgehört. Na, ich denke mal, damit lässt es sich leben, zumal schon der erste 100er-Pack womöglich die interessanteste Kollektion von Fundstellen darstellt, die mir je untergekommen ist. Und die zeitaufwendigste, weil man sich über den gesuchten Satz hinaus rasch mal festlesen kann. (mehr …)
 Slang ist womöglich die einzige linguistische Kategorie, die gerne mal etwas blumiger definiert, ja, die oft lieber beschrieben wird als definiert. Vermutlich ist das eine Folge des Umstands, dass man von Anfang an Schwierigkeiten hatte, diese Erscheinung in die bestehenden Paradigmen einzuordnen. Bei einem Begriff wie »Dialekt« ist das kein Problem. Im Falle von Slang jedoch meinte zwar jeder zu wissen, was das ist, aber wenn es dann an eine sinnvolle Abgrenzung ging… Hier möchte ich eine schon etwas betagte Definition zitieren, bei der er einem geradezu leid tun könnte, der liebe Slang.
Slang ist womöglich die einzige linguistische Kategorie, die gerne mal etwas blumiger definiert, ja, die oft lieber beschrieben wird als definiert. Vermutlich ist das eine Folge des Umstands, dass man von Anfang an Schwierigkeiten hatte, diese Erscheinung in die bestehenden Paradigmen einzuordnen. Bei einem Begriff wie »Dialekt« ist das kein Problem. Im Falle von Slang jedoch meinte zwar jeder zu wissen, was das ist, aber wenn es dann an eine sinnvolle Abgrenzung ging… Hier möchte ich eine schon etwas betagte Definition zitieren, bei der er einem geradezu leid tun könnte, der liebe Slang.
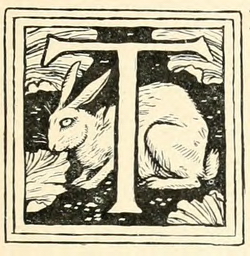 Vor ein paar Tagen sprach ich hier noch von den Bedeutungsänderungen, die einem Wort so widerfahren können. Jetzt, wo ich mir die Mühe mache, das – der ollen Fraktur wegen – nur unter ziemlichen Anstrengungen zu lesende Vorwort zu Fahrenkrügers Bailey fürs fürdere Studium abzutippen, finde ich gleich ein nettes Beispiel dafür. Fahrenkrüger erklärt im Vorwort den Gebrauch seines Dictionnaires
Vor ein paar Tagen sprach ich hier noch von den Bedeutungsänderungen, die einem Wort so widerfahren können. Jetzt, wo ich mir die Mühe mache, das – der ollen Fraktur wegen – nur unter ziemlichen Anstrengungen zu lesende Vorwort zu Fahrenkrügers Bailey fürs fürdere Studium abzutippen, finde ich gleich ein nettes Beispiel dafür. Fahrenkrüger erklärt im Vorwort den Gebrauch seines Dictionnaires Es ist ganz natürlich, die eigene Ära als eine allen anderen Zeiten weit überlegene zu sehen. Auf der anderen Seite ergibt sich daraus natürlich auch immer das Problem, dass man alles, was früher war, gern unterschätzt. Ich bin so ein Naivling, insofern es um Sprache geht. Jedenfalls muss ich das annehmen, weil ich immer wieder staune, wenn ich sprachliche Phänomene, die ach so neu scheinen, in einer anderen Zeit, in einem anderen Jahrhundert entdecke. Nehmen wir etwa das seit Jahrzehnten ins Kraut schießende Phänomen des „Schachtelworts“. Natürlich kennt man Lewis Carrolls Bildungen; und die sind nun über 100 Jahre alt. Und dennoch musste ich wieder einmal staunen, in dem im letzten Posting erwähnten Jahresband von Belford’s Monthly folgendes zu entdecken:
Es ist ganz natürlich, die eigene Ära als eine allen anderen Zeiten weit überlegene zu sehen. Auf der anderen Seite ergibt sich daraus natürlich auch immer das Problem, dass man alles, was früher war, gern unterschätzt. Ich bin so ein Naivling, insofern es um Sprache geht. Jedenfalls muss ich das annehmen, weil ich immer wieder staune, wenn ich sprachliche Phänomene, die ach so neu scheinen, in einer anderen Zeit, in einem anderen Jahrhundert entdecke. Nehmen wir etwa das seit Jahrzehnten ins Kraut schießende Phänomen des „Schachtelworts“. Natürlich kennt man Lewis Carrolls Bildungen; und die sind nun über 100 Jahre alt. Und dennoch musste ich wieder einmal staunen, in dem im letzten Posting erwähnten Jahresband von Belford’s Monthly folgendes zu entdecken: Da viele Wortneuschöpfungen, auch lausige wie „
Da viele Wortneuschöpfungen, auch lausige wie „ Gestern habe ich mir mit einiger Verspätung endlich den neuen „Szeneduden“ geleistet, das vom Trendbüro herausgegebene Wörterbuch der Szenesprachen. Ich bin ein großer Fan, letztlich schon seit dem Trendwörterbuch von Horx, das diese ebenso nützliche wie interessante „Reihe“ seinerzeit eingeleitet hat. Noch nicht mal einer wie ich, der selbst ständig in eigener Sache die Sprachfront rauf und runter hetzt, kann all die Neuschöpfungen in seiner Datenbank haben, die die völlig unübersichtliche Szenenlandschaft heute so prägen.
Gestern habe ich mir mit einiger Verspätung endlich den neuen „Szeneduden“ geleistet, das vom Trendbüro herausgegebene Wörterbuch der Szenesprachen. Ich bin ein großer Fan, letztlich schon seit dem Trendwörterbuch von Horx, das diese ebenso nützliche wie interessante „Reihe“ seinerzeit eingeleitet hat. Noch nicht mal einer wie ich, der selbst ständig in eigener Sache die Sprachfront rauf und runter hetzt, kann all die Neuschöpfungen in seiner Datenbank haben, die die völlig unübersichtliche Szenenlandschaft heute so prägen. ip laufen 08/15-Übersetzungen immer auf dasselbe hinaus: Es werden Wörter übersetzt statt Sinn. Und dann steht man im Deutschen mit einem Häuflein deutscher Wörter da, aber eben noch lange nicht mit einem anständigen deutschen Satz, geschweige denn mit gesprochenem oder gar geschriebenem Deutsch. Es fehlt oft selbst die Spur von Gespür für die idiomatische Nuance – im Englischen erkennt man sie oft erst gar nicht, im Deutschen vermag man sie nicht zu formulieren.
ip laufen 08/15-Übersetzungen immer auf dasselbe hinaus: Es werden Wörter übersetzt statt Sinn. Und dann steht man im Deutschen mit einem Häuflein deutscher Wörter da, aber eben noch lange nicht mit einem anständigen deutschen Satz, geschweige denn mit gesprochenem oder gar geschriebenem Deutsch. Es fehlt oft selbst die Spur von Gespür für die idiomatische Nuance – im Englischen erkennt man sie oft erst gar nicht, im Deutschen vermag man sie nicht zu formulieren. Wer sich gern dem Schmelz von Soul zwischen Motown und Stax und diesseits von Gospel hingibt, dem sei die Scheibe von Candi Staton empfohlen, die ich mir heute, an diesem ersten und verschneiten Sonntag im neuen Jahr bei amazon im allseits beliebten mp3-Format gezogen habe.
Wer sich gern dem Schmelz von Soul zwischen Motown und Stax und diesseits von Gospel hingibt, dem sei die Scheibe von Candi Staton empfohlen, die ich mir heute, an diesem ersten und verschneiten Sonntag im neuen Jahr bei amazon im allseits beliebten mp3-Format gezogen habe. You can’t shine shit, heißt es bei den Amerikanern so treffend, und das bedeutet: Scheiße lässt sich nun mal nicht auf Hochglanz polieren. So lässt sich auch meine Haltung gegenüber dem grassierenden Hang zu jener Art von dümmster oberflächlicher Sprachkosmetik zusammenfassen, die unter dem noch dümmeren Konzept der „Political Correctness“ firmiert.
You can’t shine shit, heißt es bei den Amerikanern so treffend, und das bedeutet: Scheiße lässt sich nun mal nicht auf Hochglanz polieren. So lässt sich auch meine Haltung gegenüber dem grassierenden Hang zu jener Art von dümmster oberflächlicher Sprachkosmetik zusammenfassen, die unter dem noch dümmeren Konzept der „Political Correctness“ firmiert. Ein halbes Stündchen pro Tag wenigstens versuche ich mich fortzubilden – ich meine ganz bewusst über das hinaus, was ich bei der Übersetzerarbeit oder der Arbeit an meinen Wörterbüchern aufschnappe. In der Regel nehme ich mir dazu etwas von einem Kollegen vor, etwas, von dem ich sowohl Original als auch Übersetzung besitze. Diese Pärchen sammle ich seit den 70er-Jahren, und inzwischen habe ich davon Hunderte, ganze Kartons voll. Aber da sie dort wenig nützen, kommen die daraus gewonnenen Erkenntnisse in die eine oder andere Datenbank. Und das läppert sich zusammen, glauben Sie mir.
Ein halbes Stündchen pro Tag wenigstens versuche ich mich fortzubilden – ich meine ganz bewusst über das hinaus, was ich bei der Übersetzerarbeit oder der Arbeit an meinen Wörterbüchern aufschnappe. In der Regel nehme ich mir dazu etwas von einem Kollegen vor, etwas, von dem ich sowohl Original als auch Übersetzung besitze. Diese Pärchen sammle ich seit den 70er-Jahren, und inzwischen habe ich davon Hunderte, ganze Kartons voll. Aber da sie dort wenig nützen, kommen die daraus gewonnenen Erkenntnisse in die eine oder andere Datenbank. Und das läppert sich zusammen, glauben Sie mir.  Wieder so eine Prägung, die nicht so recht funktionieren will. Das ganze Jahr über schon begegnet sie mir bei der morgendlichen „Presseschau“: foodoir. Als ich das Wort zum ersten Mal sah, waren meine ersten Gedanken: Ist das neuer Slang für die „Küche“? Eine Kochnische? Ein Esszimmer? Einen Winkel, in dem man vor dem Schlafengehen noch einen Happen als Betthupferl zu sich nimmt? Ein Kämmerchen, in das der schuldbewusste Gourmet sich heimlich zurückzieht, um mal… oder gar einen Raum, in dem man Gaumenfreuden mit Sex kombiniert, schließlich steht für die Amerikaner „boudoir“ weniger für das Frauenzimmer, pardon, als schlüpfrig-assoziativ für den Raum mit dem Bett. Mitnichten. „Foodoir“ kommt, wie ich zu meinem Erstaunen feststellen musste, nicht von „food“ & „boudoir“, sondern von „food“ & „memoir“.
Wieder so eine Prägung, die nicht so recht funktionieren will. Das ganze Jahr über schon begegnet sie mir bei der morgendlichen „Presseschau“: foodoir. Als ich das Wort zum ersten Mal sah, waren meine ersten Gedanken: Ist das neuer Slang für die „Küche“? Eine Kochnische? Ein Esszimmer? Einen Winkel, in dem man vor dem Schlafengehen noch einen Happen als Betthupferl zu sich nimmt? Ein Kämmerchen, in das der schuldbewusste Gourmet sich heimlich zurückzieht, um mal… oder gar einen Raum, in dem man Gaumenfreuden mit Sex kombiniert, schließlich steht für die Amerikaner „boudoir“ weniger für das Frauenzimmer, pardon, als schlüpfrig-assoziativ für den Raum mit dem Bett. Mitnichten. „Foodoir“ kommt, wie ich zu meinem Erstaunen feststellen musste, nicht von „food“ & „boudoir“, sondern von „food“ & „memoir“. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass man in Übersetzungen aus dem Englischen selten, wenn überhaupt jemals etwas spürt? Ich meine, dass etwas „gespürt“ wird? Was immer man körperlich empfindet oder wahrnimmt, es wird immer nur „gefühlt“. Und wieder einmal hat das einen ganz einfachen Grund: Die bloße morphologische Ähnlichkeit des englischen Ausgangswortes mit irgendeinem deutschen Zielwort schließt bereits den Gedanken an andere Übersetzungsmöglichkeiten kurz und damit aus.
Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass man in Übersetzungen aus dem Englischen selten, wenn überhaupt jemals etwas spürt? Ich meine, dass etwas „gespürt“ wird? Was immer man körperlich empfindet oder wahrnimmt, es wird immer nur „gefühlt“. Und wieder einmal hat das einen ganz einfachen Grund: Die bloße morphologische Ähnlichkeit des englischen Ausgangswortes mit irgendeinem deutschen Zielwort schließt bereits den Gedanken an andere Übersetzungsmöglichkeiten kurz und damit aus.  Neulich kam wieder mal die peinliche Frage, wie weit ich denn mit meinem nächsten Wörterbuch – British Slang – sei… Nun, ich hoffe, ich habe mit bislang 600 Seiten etwa die Hälfte des geplanten Volumens. Aber du machst doch schon gut sieben Jahre dran rum?! Im Prinzip sind es Jahrzehnte, aber konkret, doch, das kommt in etwa hin. Wieso das nicht schneller geht? Tja, weil es eine Schinderei ist, wenn man mehr machen will als eine poplige kleine Sammlung, die von Langenscheidt & Co. abgefeilt ist; wie schon mit American Slang und Hiphop Slang möchte ich Neues zum Thema bringen. Und das ist eben gar nicht so leicht.
Neulich kam wieder mal die peinliche Frage, wie weit ich denn mit meinem nächsten Wörterbuch – British Slang – sei… Nun, ich hoffe, ich habe mit bislang 600 Seiten etwa die Hälfte des geplanten Volumens. Aber du machst doch schon gut sieben Jahre dran rum?! Im Prinzip sind es Jahrzehnte, aber konkret, doch, das kommt in etwa hin. Wieso das nicht schneller geht? Tja, weil es eine Schinderei ist, wenn man mehr machen will als eine poplige kleine Sammlung, die von Langenscheidt & Co. abgefeilt ist; wie schon mit American Slang und Hiphop Slang möchte ich Neues zum Thema bringen. Und das ist eben gar nicht so leicht.
 Wenn ich diese Wendung höre, dann bekomme ich erst mal so einen Hals, weil ich das englische Original – what’s your opinion – dahinter höre und eine wörtliche Übersetzung vermute, die… nun ja, bei sowas kriege ich nunmal einen Hals.
Wenn ich diese Wendung höre, dann bekomme ich erst mal so einen Hals, weil ich das englische Original – what’s your opinion – dahinter höre und eine wörtliche Übersetzung vermute, die… nun ja, bei sowas kriege ich nunmal einen Hals.