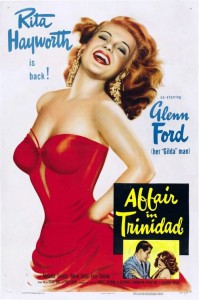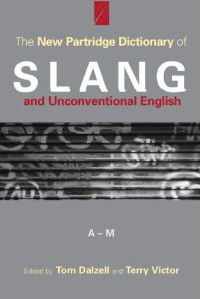Ob sprachliche Entwicklungen gut oder schlecht sind, ist meist Ansichtssache, Tatsache ist, dass Sprache sich ständig ändert. Und dass sich daran nichts ändern wird. Punkt. Herzlich fragwürdig scheint mir allerdings eine Aussage, die sich auf die Ursache einer solchen – vermeintlichen? – sprachlichen und obendrein auch »mentalen« (wie man heute wohl sagt) Änderung bezieht. Ich fand sie vor einigen Wochen in einem Interview in der Süddeutschen und sie scheint mir von einem, der buchstäblich nicht in diesem Land lebt – oder überhaupt in unserer modernen Zeit…
»Heutzutage«, so erklärte Franziska Augstein in einem Interview dem deutsch-französischen Autor Georges-Arthur Goldschmidt, reden wir umgangssprachlich in Deutschland so: ›Ich sitze gern im Café Figaro, weil: ich mag das Café.‹« Worauf Goldschmidt meint: »Das Deutsche ist freier geworden. Man lässt sich Zeit zum Denken, daher die Zäsur: ›weil‹: – Nachdenken – und dann kommt das Resultat.«
Das ist, mit Verlaub, ein Riesenkrampf. Nicht nur gibt es bei einem solchen Satz nichts zu überlegen, es besteht noch nicht mal ein Grund, das Verb nach vorne zu verlegen, weil man’s eventuell vergessen könnte, wenn man es, wie im deutschen Nebensatz üblich, hinten dranhängt. Dafür ist der Satz zu kurz. Zu einer Zäsur kommt es mitnichten. Und von der Aussage her scheint mir bei einem solchen Satz ohnehin der Nebensatz der eigentlich wichtige: Man will letztlich nur sagen, dass man das Restaurant mag; der Nebensatz würde – als Hauptsatz gesprochen – genügen. Oder bilde ich mir das nur ein? Ist ja nicht auszuschließen…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wie auch immer, seit ich das Interview gelesen habe, höre ich die Konstruktion plötzlich, na gut, wenn schon nicht überall so doch im TV. Allein letzte Woche wenigstens viermal.
»Ich trage Ohrenstöpsel, weil ich hab’ so ’n leichten Schlaf«, antwortet im Notruf Hafenkante die Haushälterin eines alternden Stars auf die Frage, ob sie denn nicht gehört hätte, dass jemand nächtens mit dem Tresor stiften geht.
Und dann gleich noch mal: »War’s das, weil ich müsste noch …« Und ein drittes Mal in derselben Episode: »Das ist im Moment schlecht, weil ich bin grade beim …« (mehr …)