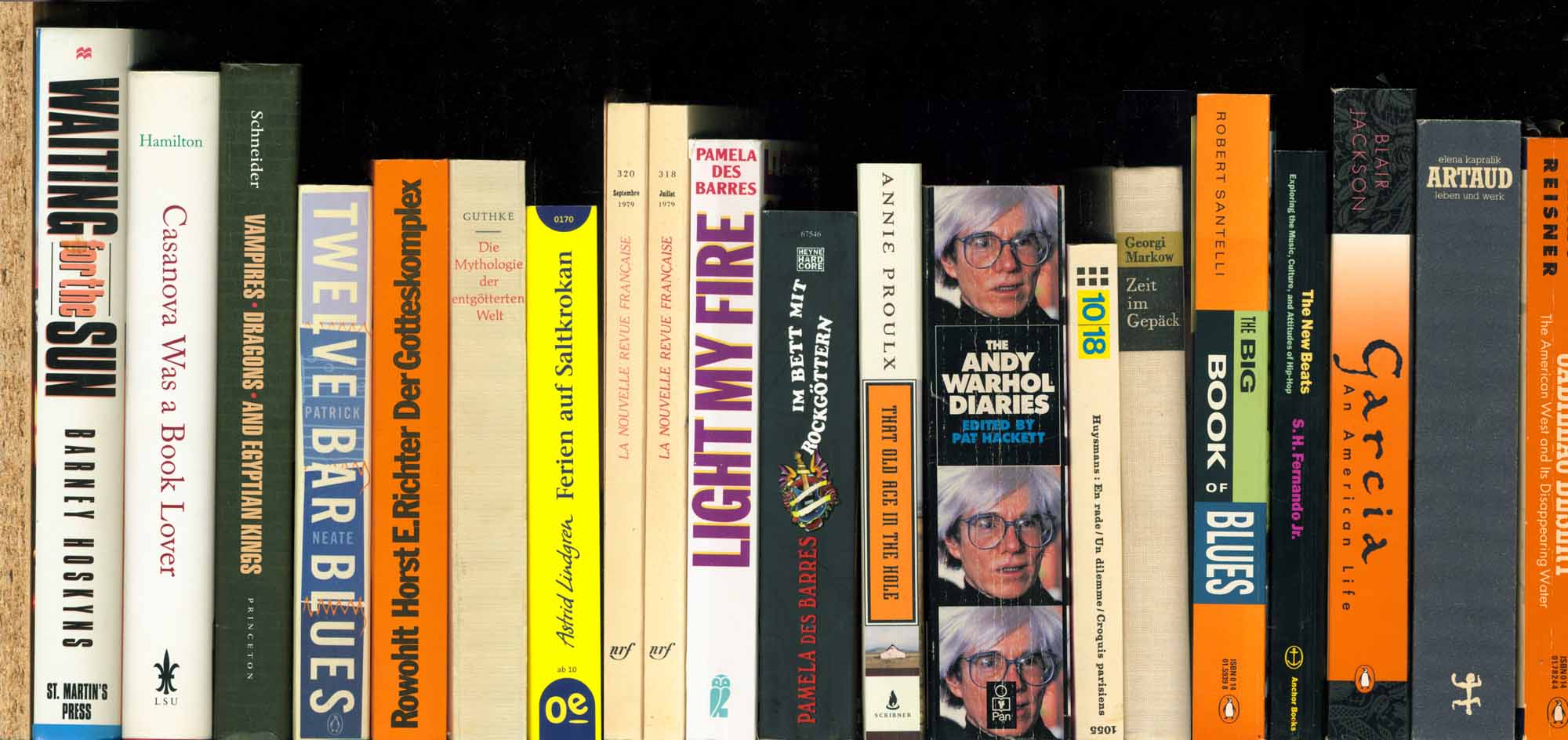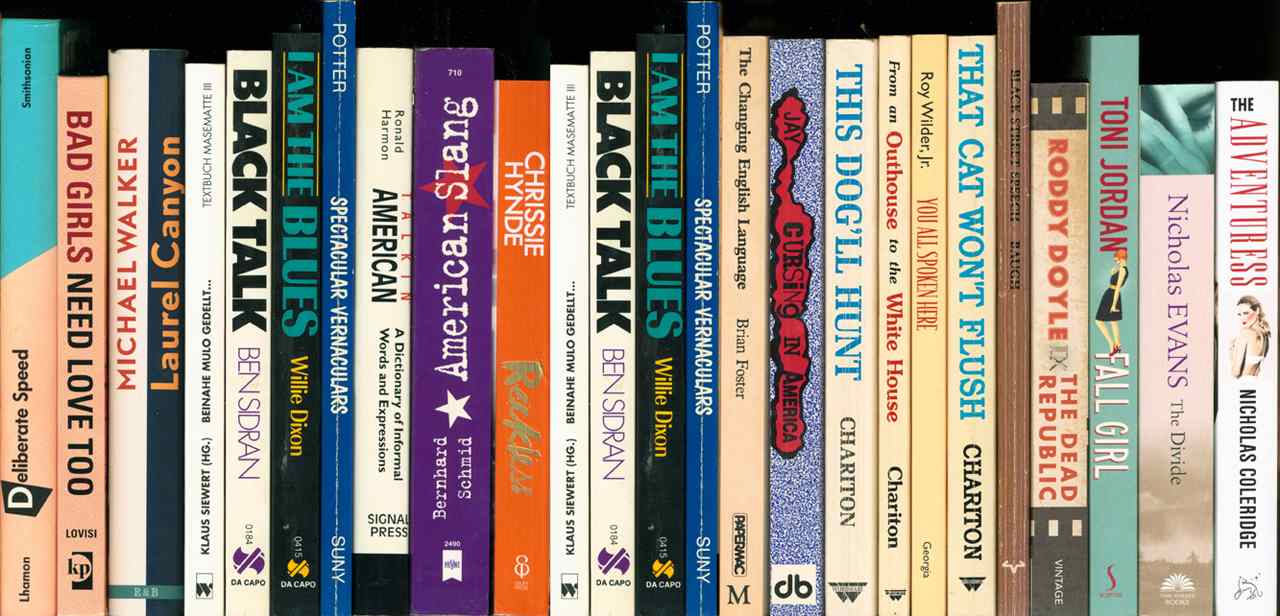Das Dreckige Dutzend (1)
Ich schaue mir als Übersetzer sehr viele Übersetzungen an; zusammen mit dem Original. Satz für Satz. Seit den 1970er-Jahren schon. Das ist eine gute Möglichkeit, sich das eine oder andere abzugucken. Es gibt immer eine Lösung für ein Problem, die automatisch – in einer Datenbank – parat zu haben, ganz praktisch ist; es gibt immer eine, auf die man selbst nicht gekommen wäre. Und natürlich findet man dabei auch jede Menge kleineren oder größeren – auch himmelschreienden – Murks. Das hat mich vor einigen Jahren auf die Idee gebracht, derlei Klöpse in einer Glosse zusammenzutragen. Nicht alle, das wäre nicht zu schaffen und langweilig obendrein, aber ein Dutzend pro Titel scheint mir durchaus vertretbar. Also, bitteschön, das erste dreckige Dutzend.
Ich könnte nicht sagen, ob Übersetzungen heute schlechter denn je sind, das erforderte etwas umfassendere statistische Arbeit; ich kann nur sagen, dass sie trotz all der Möglichkeiten, die sich dem Übersetzer heute bieten, nicht besser geworden zu sein scheinen. Aber ehrlich gesagt, wie sollten sie auch? Übersetzerseitig tummeln sich heute in diesem Metier mehr blutige Amateure denn je.1 Und verlagsseitig sieht es nicht viel besser aus. Alles, was zu faul zum Arbeiten ist, bietet sich heute als freier Lektor an. Über das Lektorat – frei oder nicht – habe ich hier im Blog schon das eine oder andere gesagt, ich möchte die einschlägige Arie hier mal außen vor lassen; Tatsache ist, der Übersetzer hat heute weniger über den Inhalt »seiner« Übersetzung zu bestimmen denn je.2 Deshalb ist »das dreckige Dutzend« auch keine Übersetzerkritik, sondern eine Übersetzungskritik, will sagen eine Kritik des fertigen Produkts, das in jedem Falle besagtes Lektorat zu verantworten hat.3
Ich habe eben das mehr oder weniger verkaufsfertige Produkt »meiner« vorvorletzten Übersetzung zurückbekommen, Teil eines Schnellschusses zu einem aktuellen Thema, bei dem ich einer von vielen war.4 Im Begleitschreiben aus dem Lektoratsbüro heißt es sinngemäß, Hinweise auf »Böcke« nehme man gern entgegen, was natürlich reine Rhetorik ist. Ich meine, wann hätte ein Lektor schon mal einen Fehler gemacht? (mehr …)
- Den Grund dafür habe ich mal angerissen. [↩]
- Falls es andere Lektoren gibt, keine Ahnung, wie die guten Übersetzungen, die ich so finde, zustande gekommen sind, melden Sie sich doch bei mir. [↩]
- Darüber dann im Rahmen dieser Serie ein andermal mehr. [↩]
- Das Schnellschüsse von vielen gemacht werden müssen, ist auch so eine Unsitte der Branche, die noch einer näheren Erklärung bedarf. Sie folgt irgendwann in diesem Theater. [↩]