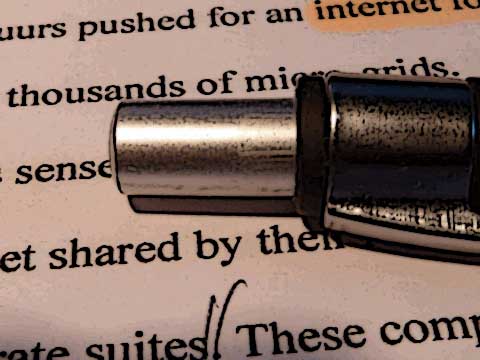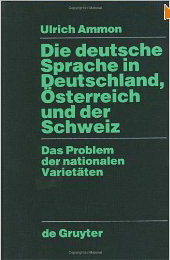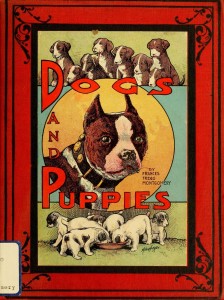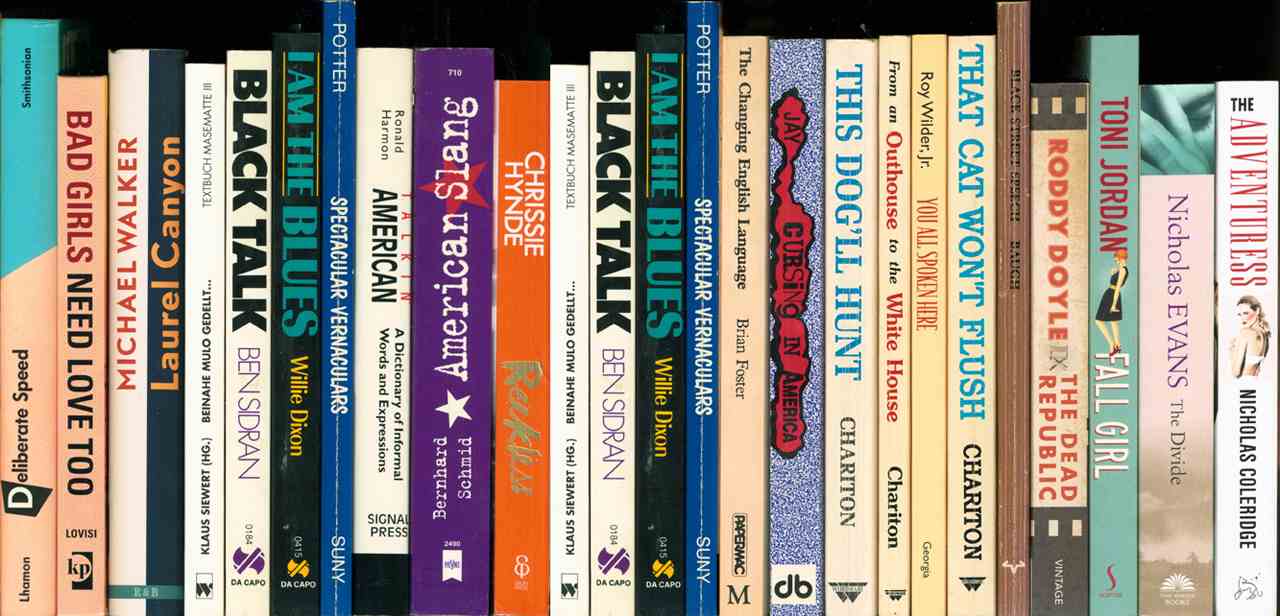»Trümmel« – (m)eine kleine Obsession
Das Schöne an einem Blog ist nicht nur, dass es einen zwingt, den einen oder anderen Gedanken, den man sich merken möchte, so zu formulieren, dass ihn auch ein anderer versteht; das macht ein Blog zu einem ganz brauchbaren Notizblock, der der alten Zettelwirtschaft haushoch überlegen ist. Aber als »Publikation«, ein Blog ist ja weltweit einsehbar, hat es auch den Vorteil, seinen Obsessionen öffentlich für einige Interessierte nachgehen zu können, ohne damit denen auf den Nerv zu fallen, die diese partout nicht interessieren. So im Falle des Wörtchens »«, das mich nicht mehr loslassen mag, seit ich es entdeckt habe. Obsession hin oder her, die Zahl der Leute, die die Suche nach dem Wörtchen auf das Blog führt, ist durchaus erstaunlich.
»Trümmlig«1 – das Wort mag mich einfach nicht in Ruhe lassen. Und nachdem mein Freund Herbert Pfeiffer mich mit dem Schweizerischen Idiotikon2 jüngst auf ein Werk aufmerksam gemacht hat, das ich von Anfang an hätte benutzen sollen, hier nochmal ein Nachwasch (falls es so etwas gibt).
Das Schweizerische Idiotikon. Was für ein Fund! Das Schweizerische aller Zeiten bis ins kleinste Detail seziert, geordnet und auch noch feinsäuberlich in eine Website eingepflegt.3 Das ist genau das, was man sich von allen deutschsprachigen Gegenden wünschen würde.
Wie auch immer: »trümmlig« ist hier auf den Punkt gebracht. Wenn auch etwas eingehender, als der beiläufig Nachschlagende sich das wünschen würde. Und ich sehe, dass meinen bisherigen Ausführungen nichts hinzuzufügen ist, ohne sie unnötig zu komplizieren. So möchte ich denn hier auch lieber auf einige verwandte Wörter eingehen, auf die ich beim Nachlesen gestoßen bin. Und da sich das Nachschlagen ob der Fülle von Informationen gar nicht so einfach gestaltet, bereite ich das hier mal auf. (mehr …)
- siehe dazu , & . [↩]
- Mit bisher 15 abgeschlossenen Bänden und dem zu fünf Sechsteln erschienenen 16. Band, die zusammen rund 150 000 Stichwörter enthalten, ist das Schweizerische Idiotikon schon vor seinem Abschluss das umfangreichste Regionalwörterbuch im deutschen Sprachraum. Es dokumentiert die deutsche Sprache in der Schweiz vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart, die älteren Sprachstufen genauso wie die lebendige Mundart. Da der Grundstock des Mundartmaterials in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dank der Mitarbeit von gegen 400 Korrespondenten zusammengekommen ist, kann das Werk sonst kaum beschriebene und heute weitgehend verschwundene Bereiche der sprachlichen, geistigen und materiellen Kultur dieser Zeit besonders gut dokumentieren. Es ist Arbeitsinstrument für verschiedenste Wissensgebiete wie Sprach‑, Geschichts- und Rechtswissenschaft, Volks- und Namenkunde. Das Gesamtwerk wird 17 Bände umfassen. Auf den Abschluss hin sind Arbeiten an einem alphabetischen und einem grammatischen Gesamtregister in Gang. Überdies werden eine Kompaktausgabe (Volksausgabe) und eine Online-Ausgabe des Werks vorbereitet. [↩]
- Kein Mensch könnte sich das Teil privat leisten, da bin ich mir sicher, auch ohne nach dem Preis geschaut zu haben. Vielleicht klappt es bei der geplanten Volksausgabe. [↩]