So einen Hals könnte man kriegen…
… schon in aller Herrgottsfrüh bei der ersten Presseschau im Web. Kaum dass man in eine der digitalen Gazetten guckt, um zu sehen, was es Neues gibt, quillt einem das lausige Deutsch amateurhafter Übersetzungen entgegen.

Ich will ja gar nicht davon anfangen, wie einfach es heute der Journalist zu haben scheint, sich seine Artikelchen zusammenzuschustern – er braucht sich offensichtlich nur im Web einen Beitrag in einer fremden Sprache zu suchen und zu übersetzen. Fertig ist die Laube. Von mir aus; mir ist es egal, wie originell meine tägliche Dosis Klatsch bei der ersten Tasse Kaffee ist, wenn sie nur tatsächlich ins Deutsche übersetzt wäre und nicht einfach hirnlos englische Wörter durch deutsche Wörter ausgetauscht würden. Möglichst in derselben Reihenfolge. Vermiest einem einfach den ganzen Tag so was, wenigstens mir als Übersetzer.
Ein paar Beispiele von heute Morgen aus einer Mitteilung über die Dreharbeiten zur Actionkomödie Knight and Day. Es geht um Cameron Diaz und Tom Cruise. (mehr …)

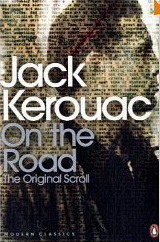



 … die interessanteste Wendung, die man so googeln kann.
… die interessanteste Wendung, die man so googeln kann.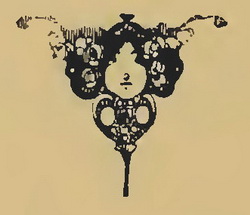 Es ist eine alte Weisheit: Die Beschäftigung mit einer Übersetzung hilft dem Autor nicht selten dabei, seine eigenen Gedanken zu klären. Aber selten habe ich das so deutlich ausgesprochen gesehen wie bei André Gide. Der nämlich schrieb 1930 im Vorwort zur deutschen Ausgabe seiner Nourritures folgendes:
Es ist eine alte Weisheit: Die Beschäftigung mit einer Übersetzung hilft dem Autor nicht selten dabei, seine eigenen Gedanken zu klären. Aber selten habe ich das so deutlich ausgesprochen gesehen wie bei André Gide. Der nämlich schrieb 1930 im Vorwort zur deutschen Ausgabe seiner Nourritures folgendes:
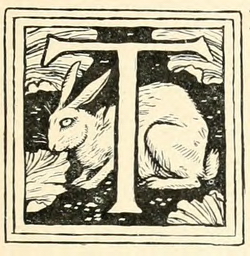 Vor ein paar Tagen sprach ich hier noch von den Bedeutungsänderungen, die einem Wort so widerfahren können. Jetzt, wo ich mir die Mühe mache, das – der ollen Fraktur wegen – nur unter ziemlichen Anstrengungen zu lesende Vorwort zu Fahrenkrügers Bailey fürs fürdere Studium abzutippen, finde ich gleich ein nettes Beispiel dafür. Fahrenkrüger erklärt im Vorwort den Gebrauch seines Dictionnaires
Vor ein paar Tagen sprach ich hier noch von den Bedeutungsänderungen, die einem Wort so widerfahren können. Jetzt, wo ich mir die Mühe mache, das – der ollen Fraktur wegen – nur unter ziemlichen Anstrengungen zu lesende Vorwort zu Fahrenkrügers Bailey fürs fürdere Studium abzutippen, finde ich gleich ein nettes Beispiel dafür. Fahrenkrüger erklärt im Vorwort den Gebrauch seines Dictionnaires Es ist ganz natürlich, die eigene Ära als eine allen anderen Zeiten weit überlegene zu sehen. Auf der anderen Seite ergibt sich daraus natürlich auch immer das Problem, dass man alles, was früher war, gern unterschätzt. Ich bin so ein Naivling, insofern es um Sprache geht. Jedenfalls muss ich das annehmen, weil ich immer wieder staune, wenn ich sprachliche Phänomene, die ach so neu scheinen, in einer anderen Zeit, in einem anderen Jahrhundert entdecke. Nehmen wir etwa das seit Jahrzehnten ins Kraut schießende Phänomen des „Schachtelworts“. Natürlich kennt man Lewis Carrolls Bildungen; und die sind nun über 100 Jahre alt. Und dennoch musste ich wieder einmal staunen, in dem im letzten Posting erwähnten Jahresband von Belford’s Monthly folgendes zu entdecken:
Es ist ganz natürlich, die eigene Ära als eine allen anderen Zeiten weit überlegene zu sehen. Auf der anderen Seite ergibt sich daraus natürlich auch immer das Problem, dass man alles, was früher war, gern unterschätzt. Ich bin so ein Naivling, insofern es um Sprache geht. Jedenfalls muss ich das annehmen, weil ich immer wieder staune, wenn ich sprachliche Phänomene, die ach so neu scheinen, in einer anderen Zeit, in einem anderen Jahrhundert entdecke. Nehmen wir etwa das seit Jahrzehnten ins Kraut schießende Phänomen des „Schachtelworts“. Natürlich kennt man Lewis Carrolls Bildungen; und die sind nun über 100 Jahre alt. Und dennoch musste ich wieder einmal staunen, in dem im letzten Posting erwähnten Jahresband von Belford’s Monthly folgendes zu entdecken: ip laufen 08/15-Übersetzungen immer auf dasselbe hinaus: Es werden Wörter übersetzt statt Sinn. Und dann steht man im Deutschen mit einem Häuflein deutscher Wörter da, aber eben noch lange nicht mit einem anständigen deutschen Satz, geschweige denn mit gesprochenem oder gar geschriebenem Deutsch. Es fehlt oft selbst die Spur von Gespür für die idiomatische Nuance – im Englischen erkennt man sie oft erst gar nicht, im Deutschen vermag man sie nicht zu formulieren.
ip laufen 08/15-Übersetzungen immer auf dasselbe hinaus: Es werden Wörter übersetzt statt Sinn. Und dann steht man im Deutschen mit einem Häuflein deutscher Wörter da, aber eben noch lange nicht mit einem anständigen deutschen Satz, geschweige denn mit gesprochenem oder gar geschriebenem Deutsch. Es fehlt oft selbst die Spur von Gespür für die idiomatische Nuance – im Englischen erkennt man sie oft erst gar nicht, im Deutschen vermag man sie nicht zu formulieren. Ein halbes Stündchen pro Tag wenigstens versuche ich mich fortzubilden – ich meine ganz bewusst über das hinaus, was ich bei der Übersetzerarbeit oder der Arbeit an meinen Wörterbüchern aufschnappe. In der Regel nehme ich mir dazu etwas von einem Kollegen vor, etwas, von dem ich sowohl Original als auch Übersetzung besitze. Diese Pärchen sammle ich seit den 70er-Jahren, und inzwischen habe ich davon Hunderte, ganze Kartons voll. Aber da sie dort wenig nützen, kommen die daraus gewonnenen Erkenntnisse in die eine oder andere Datenbank. Und das läppert sich zusammen, glauben Sie mir.
Ein halbes Stündchen pro Tag wenigstens versuche ich mich fortzubilden – ich meine ganz bewusst über das hinaus, was ich bei der Übersetzerarbeit oder der Arbeit an meinen Wörterbüchern aufschnappe. In der Regel nehme ich mir dazu etwas von einem Kollegen vor, etwas, von dem ich sowohl Original als auch Übersetzung besitze. Diese Pärchen sammle ich seit den 70er-Jahren, und inzwischen habe ich davon Hunderte, ganze Kartons voll. Aber da sie dort wenig nützen, kommen die daraus gewonnenen Erkenntnisse in die eine oder andere Datenbank. Und das läppert sich zusammen, glauben Sie mir.  Wieder so eine Prägung, die nicht so recht funktionieren will. Das ganze Jahr über schon begegnet sie mir bei der morgendlichen „Presseschau“: foodoir. Als ich das Wort zum ersten Mal sah, waren meine ersten Gedanken: Ist das neuer Slang für die „Küche“? Eine Kochnische? Ein Esszimmer? Einen Winkel, in dem man vor dem Schlafengehen noch einen Happen als Betthupferl zu sich nimmt? Ein Kämmerchen, in das der schuldbewusste Gourmet sich heimlich zurückzieht, um mal… oder gar einen Raum, in dem man Gaumenfreuden mit Sex kombiniert, schließlich steht für die Amerikaner „boudoir“ weniger für das Frauenzimmer, pardon, als schlüpfrig-assoziativ für den Raum mit dem Bett. Mitnichten. „Foodoir“ kommt, wie ich zu meinem Erstaunen feststellen musste, nicht von „food“ & „boudoir“, sondern von „food“ & „memoir“.
Wieder so eine Prägung, die nicht so recht funktionieren will. Das ganze Jahr über schon begegnet sie mir bei der morgendlichen „Presseschau“: foodoir. Als ich das Wort zum ersten Mal sah, waren meine ersten Gedanken: Ist das neuer Slang für die „Küche“? Eine Kochnische? Ein Esszimmer? Einen Winkel, in dem man vor dem Schlafengehen noch einen Happen als Betthupferl zu sich nimmt? Ein Kämmerchen, in das der schuldbewusste Gourmet sich heimlich zurückzieht, um mal… oder gar einen Raum, in dem man Gaumenfreuden mit Sex kombiniert, schließlich steht für die Amerikaner „boudoir“ weniger für das Frauenzimmer, pardon, als schlüpfrig-assoziativ für den Raum mit dem Bett. Mitnichten. „Foodoir“ kommt, wie ich zu meinem Erstaunen feststellen musste, nicht von „food“ & „boudoir“, sondern von „food“ & „memoir“.